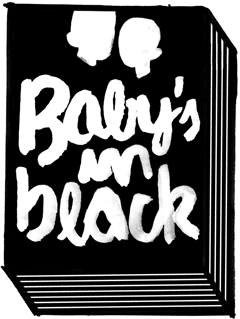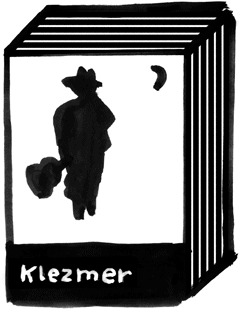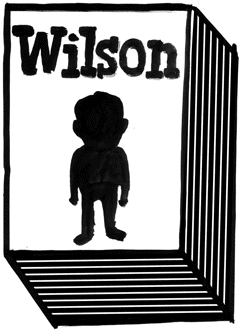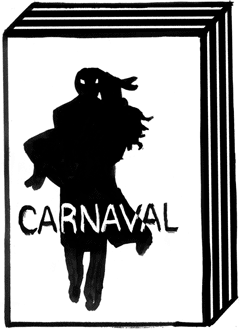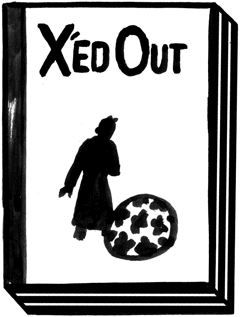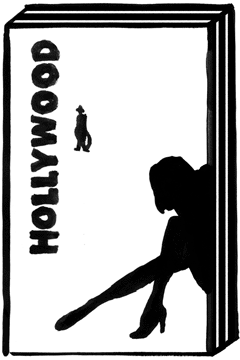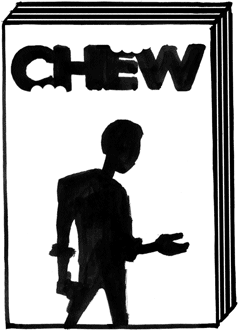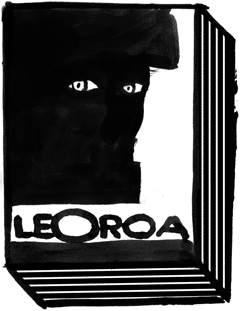|
 |
 |
Eine Beatles-Ballade
Die Anfänge der Beatles in Hamburg: Elektrifiziert vom Rock’n’Roll der fünf charmanten Jungs aus Liverpool, müssen Künstler und Designer wie Klaus Voormann und Astrid Kirchherr – um die Band live zu sehen – ihren bürgerlichen Kosmos verlassen und in die Niederungen übel beleumundeter, verrauchter Kaschemmen eintauchen, zu ungeschlachten Seeleuten, kleinen Gaunern und Nutten. Dort entfaltet sich die tragische Romanze zwischen dem ersten Beatles-Bassisten Stuart Sutcliffe und Astrid Kirchherr (die in die Geschichte einging als die Fotografin, welche die ersten professionellen Bilder der Beatles schoss und ausserdem verantwortlich war für deren Pilzköpfe …). Ausgehend von langen Gesprächen mit Astrid Kirchherr verschmilzt Bellstorf in seinem zweiten Comic-Roman «Baby’s in Black» beide Handlungsstränge zu einer atmosphärisch dichten Beschwörung der Jugendkulturen im Hamburg der frühen 1960er-Jahre. Es geht um Rock’n’Roll und um Liebe, um den Traum vom grossen Erfolg oder erste Drogenexzesse. Aber in erster Linie ist es eine Geschichte über das Erwachsenwerden in einer noch sehr rigiden Gesellschaft, über das allmähliche Entstehen einer neuen Jugendkultur zwischen Aufbruchseuphorie, Rebellion, Bohème und Anpassung. Seit seinem beachtlichen Einstand «Acht, neun, zehn» hat sich Bellstorf von seinen Vorbildern Clowes und Ware frei gezeichnet; sein reduzierter, hie und da von schmutzigen Schatten verschlierter Schwarzweiss-Strich stützt die subtile und eindringliche Atmosphäre seiner ausgezeichnet erzählten Geschichte. Manchmal sind die Zeichnungen, gerade bei den Gesichtern, eine Spur zu zurückhaltend – es ist nicht immer einfach, die jungen Männer auseinander zu halten, da sie alle dunkle Haare haben, schwarze Pullover tragen und irgendwie süss aussehen. Unverständlich ist allerdings, warum Bellstorf die Beatles englisch reden lässt. Es soll wohl Authentizität suggerieren, doch wirkt es eher snobistisch und schliesst die des Englischen nicht mächtigen Leserinnen und Leser aus, zumal die winzig klein verfasste Übersetzung am Schluss des Buchs keine echte Hilfe leistet. Das ist schade, denn abgesehen davon ist «Baby’s in Black» sehr gelungen. Bellstorf schafft es aufs Schönste, die Fakten und eine Prise Fiktion auf eine immer sehr natürliche, glaubhafte und nie bemühte Weise zu einer berührenden Liebesgeschichte zu verbinden.
Christian Gasser
Arne Bellstorf: «Baby’s in Black. The Story of Astrid Kirchherr & Stuart Sutcliffe».
Reprodukt Verlag, 216 S., Softcover, s/w,
Euro 20.– / ca. sFr. 31.–
|
| Cover-Illustrationen von Nadine Spengler
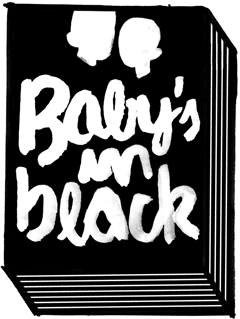
«Baby’s in Black.
The Story of Astrid Kirchherr & Stuart Sutcliffe»
|
| |
|
|
Subjektivismus
Bastien Vivès deutet in seinem letzten Werk «Der Geschmack von Chlor» eine Romanze an. Der Ort der Begegnung – ein Schwimmbad – gibt die visuelle Gestaltung vor. Die zarte Annäherung zweier Menschen erzählt er grafisch auf konsequente und beeindruckende Art in schönen Blautönen – und nicht selten unter Wasser. Auch in seinem neuen Werk erzählt er wieder von einer aufkeimenden Liebe, und wieder steht der Geschichte eine ganz besondere visuelle Umsetzung zur Seite: Bastien Vivès unternimmt mit «In meinen Augen» den Versuch eines Comics aus umgesetzt subjektiver Perspektive. Das ist tatsächlich visuell zu verstehen – analog zur subjektiven Kamera im Film. Man sieht also nie den Erzähler, sondern immer nur, was der Erzähler sieht. Der Namenlose lernt in der Bibliothek eine Frau kennen und ist gleich von ihrer Ausstrahlung fasziniert. Gemeinsam gehen sie essen, auf eine Party, in den Zoo und ins Kino. Schnell entwickelt sich eine kleine Liebesgeschichte, doch die ersten Probleme lauern schon.
Der Erzähler ist in der Geschichte nie zu sehen, er ist aber auch nicht zu ‹hören›. Zwar gibt es viele Szenen, in denen der Erzähler seinen Schwarm nur anschmachtet, also nur als Beobachter fungiert. In diesen Momenten ist der Comic kaum von herkömmlich erzählten Geschichten zu unterscheiden. Wenn er aber verbal oder auch nonverbal mit dem Mädchen kommuniziert, dann muss der Leser erst anhand der verbalen, gestischen und mimischen Reaktionen des Mädchens ergründen, was der unsichtbare Protagonist wohl gerade gemacht oder ge-sagt hat. Besondere Momente entstehen, wenn Dritte auftauchen oder bei körperlichen Interaktionen, beispielsweise wenn sich das Paar küsst. Dann wird ihr Mund immer grösser, bis sich das Panel schliesslich schwarz füllt wie eine Kreisblende. Natürlich – unser Held schliesst seine Augen beim Küssen. Vivès gelingt nicht nur das Formexperiment hervorragend, er weiss, mit seiner zweiten Liebesgeschichte voller Andeutungen auch wieder emotional zu überzeugen.
Christian Meyer
Bastien Vivès: «In meinen Augen».
Reprodukt, 136 S. Softcover, farbig,
Euro 18.— / sFr. 27.90
|
|
 «In meinen Augen»
|
| |
|
|
Stereotypen
«Diebe, alles Diebe» nennt Joann Sfar den dritten Band seiner aquarellierten Comic-Reihe «Klezmer». Er hätte ihn auch «Stereotypen, alles Stereotypen» nennen können, denn der Comic wimmelt von Klischees ‹des Juden›. Es treten auf: der «dämonische Jude», die «schöne Jüdin», der «schlaue Jude» etc.
Aber während dies anderswo mehr als problematisch zu bewerten wäre, zeigt es bei Sfar ein historisches Bewusstsein für die prekäre Lebenssituation osteuropäischer Juden vor der Shoah. Der gesellschaftliche Antisemitismus, vor dem die Musiker in den ersten beiden Bänden nach Odessa geflohen waren, reduzierte sie auf jene Klischees, machte sie zu Projektionsflächen, die nach Belieben mit diesen Stereotypen gefüllt werden konnten. Sfar zeigt in seinem Comic den harten Kampf, diese einengenden Bilder endlich überschreiten zu können, in seiner ganzen Konsequenz. Möglich wird diese Freiheit von Stereotypen erst in einer von den Musikern gegründeten «autonomen Künstlerrepublik» im Haus einer nach Palästina
ausgewanderten Jüdin aus Odessa. Dieses Haus wird zu ihrem «heiligen Land», zu einer Parabel auf die historische Entstehung des Zionismus. Ein Thema, das Sfar auch in seinem umfangreichen Nachwort thematisiert. Nebenbei machen die Musikerfreunde Bekanntschaft mit der Unterwelt Odessas, mit den titelgebenden Dieben jedoch sind nicht sie selber gemeint, sondern eine russische «Delegation für Volkskunst», die jüdische Musik als Volksmusik in ihr politisches Kulturprogramm integrieren will. Diese Aneignungsversuche bezahlen sie mit blauen Augen.
Von denen gibt es auch in dem bereits Ende der 1990er in Frankreich erschienenen und nun auch auf Deutsch vorliegenden Werk «Die Tochter des Professors» reichlich. Die Zeichnungen stammen von Emmanuel Guibert, der Text von Sfar und auch hier ist wieder eine Freude am Spiel mit Klischees und deren Überschreitung zu erkennen. Und dies – sowohl, was «Klezmer» als auch «Die Tochter des Professors» betrifft – durchaus mit einem historischen und politischen Bewusstsein.
Angesiedelt im späten 19. Jahrhundert, verfolgt der Comic die Liebesgeschichte zwischen Liliane, der Tochter eines Professors, und Imhotep IV. beziehungsweise seiner Mumie. Abgesehen davon, dass der Comic sehr schön das London jener Zeit einfängt, bekannte Motive, etwa Sherlock Holmes, zitiert und in seinen absurden Verwicklungen oftmals wirklich lustig ist, weist er über jenen inhaltlichen Aspekt hinaus. «Sie sind das Eigentum des British Museum. Halten Sie sich da raus», befiehlt der Professor der Mumie. Das Eindringen Imhotep IV. in die englische Gesellschaft kann als Kritik an der im British Museum zum Ausdruck kommenden imperialistischen Geste des British Empire gelesen werden und die Forderung der Mumie, als Teil dieser Gesellschaft auch Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, als Beitrag zu einer wohl leider immer wieder aktuellen Integrationsdebatte.
Jonas Engelmann
Joann Sfar: «Klezmer – Diebe, alles Diebe».
Avant-Verlag, 148 S., Softcover, farbig,
Euro 19.90 / sFr. 30.50
Emmanuel Guibert/Joann Sfar: «Die Tochter des Professors».
Bocola, 62 S., Hardcover, farbig,
Euro 14.90 / sFr. 23.50
|
|
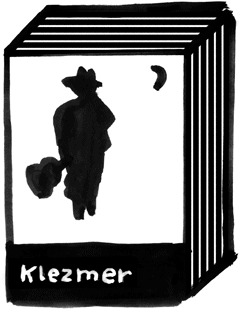
«Klezmer – Diebe, alles Diebe»
|
| |
|
|
Der Ton der Träume
Oji Suzuki ist in vielen Künsten bewandert.
In Tokio produziert der 62-Jährige Kurzfilme, tritt als Musiker auf und publiziert Kinderbücher. Als Comic-Autor machte er sich ab Ende der 1960er-Jahre einen Namen mit Kurzgeschichten, die im Avantgardemagazin Garo erschienen sind. Diese Vielseitigkeit überträgt Suzuki spielend auf seine Mangas, die menschliche Grundgefühle an der Grenze von Wahrnehmung, Erinnerung und Verlust behandeln.
Mit «A Single Match» hat der kanadische Verlag Drawn & Quarterly die erste Sammlung von Suzuki-Kurzgeschichten in englischer Sprache herausgegeben. Alle Geschichten sind im wahrsten Sinne von Wort und Bild traumwandlerisch und poetisch.
Das beginnt bei den klangvollen und hoch assoziativen Titeln, die mit Bildern wie «Die Farbe des Regens» oder «Die Nachtkerze» oder «Gläserne Gedanken» spielen. Das Traumhafte setzt sich bruchlos in der Dramaturgie und im Erzählfluss fort: Der Blick folgt den zwischen Personen, Objekten und Landschaften mäandrierenden Panels, gebannt und oft ahnungslos, was die nächste Seite offenbart.
Die Protagonisten sind stille Menschen, die sich nicht selten in der Mitte eines Raumes zusammenkauern oder deren Gesichter sich in Schatten und Dunkelheit auflösen. Doch es sind auch Menschen, die sich überraschend erheben, um den Nachthimmel zu durchwandern und sich der Realität in einer Gegenwelt zu entziehen. Immer geht es dabei um die Beziehungen zwischen Menschen untereinander und zu ihrer Umwelt. Da gibt es den jungen Mann, der sich im Regen erkältet und von einer Zugfahrt träumt, auf der ihn der Bruder begleitet, den er nicht hat. Da gibt es die junge Frau, die mit dem Fahrrad unterwegs ist und von einem Freund begleitet wird, der einen schwebenden Kopf, aber keinen Körper hat. Und mitunter wandelt sich mit dem Wechsel der Realitäten auch der Zeichenstil und was als Funny-Comic beginnt, endet dann im Realismus. «A Single Match» ist ein Comic, der all die Leserinnen und Leser anspricht, die sich gerne im Fluss einer fremden Erzählung treiben und Bilder frei sprechen lassen.
Florian Meyer
Oji Suzuku: «A Single Match».
Drawn & Quarterly, 270 S., Hardcover, s/w,
Euro 17.95 / sFr. 39.90
|
|

«A Single Match»
|
| |
|
|
Welt voller Abgründe
Eine grössere Fangemeinde hat Daniel Clowes vor allem mit seinem Teenager-Porträt «Ghost World» erworben. Bereits in den 1990er Jahren hat er sich damit einen Ehrenplatz in der Comic-Geschichte reserviert. Und nicht nur dort, denn die gleichnamige Verfilmung von Terry Zwigoff machte ihn auch über die Grenzen der Comic-Szene hinaus bekannt. Schon vorher war er mit seiner Heftreihe «Eightball» ein Star der Independent-Comic-Szene. Die längeren Fortsetzungsgeschichten aus «Eightball» liegen bereits in Buchform vor. Nun erscheint zehn Jahre nach der amerikanischen Buchausgabe endlich die deutsche Übersetzung der gesammelten «Eightball»-Stories um «David Boring». Es ist eine ausufernde Geschichte um den Titelhelden, der auf der Suche nach einer Frau und seiner eigenen Vergangenheit in allerlei Abenteuer gerissen wird. Die stilisierten Zeichnungen auf Rasterpapier unterstreichen die kühle, surreale Stimmung der virtuos verschachtelten Erzählung.
Im Frühling darf man sich auch auf die Neuauflage von Clowes’ nicht weniger verwirrender Story «Ein samtener Handschuh in eisernen Fesseln» freuen (erstmals 1993 auf Deutsch erschienen). Ein Mann glaubt, in einem Pornofilm eine Frau zu erkennen und begibt sich auf die Suche nach ihr. Dabei trifft er auf eine Sekte, auf Verschwörungstheoretiker, mutierte Wesen, korrupte Cops und Killer. Das gesellschaftliche Gefüge mit seinen Sicherheit suggerierenden Regeln ist hier wie in «David Boring» nicht nur rissig, es ist zerbröckelt und zu Tage treten Albträume, die David Lynchs Filmen in nichts nachstehen.
Clowes’ aktuelles Werk «Wilson» trägt hingegen wie «Ghost World» keine fantastischen Züge. Der Protagonist ist kein Teenager, Wilson könnte vielmehr einer der zahlreichen zwielichtigen Nerds mittleren Alters sein, die in Clowes’ Stories als Nebenfiguren auftauchen: Er ist ein Misanthroph vor dem Herrn, und Clowes breitet sein deprimierendes Leben schonungslos – mal in Karikaturen, mal realistischer gezeichnet – vor dem Leser aus. Nach und nach erkennt Wilson, was in seinem Leben schief gelaufen ist und warum. Am Ende obsiegt sogar so etwas wie Selbsterkenntnis und die Fähigkeit, die Dinge zu nehmen, wie sie sind.
Christian Meyer
Daniel Clowes: «David Boring».
Reprodukt, 128 S., Softcover, farbig & s/w,
Euro 20.– / sFr. 29.90
Daniel Clowes: «Ein samtener Handschuh in eisernen Fesseln».
Reprodukt, 136 S., Softcover, s/w,
Euro 18.– / ca. sFr. 30.–
Daniel Clowes: «Wilson».
Eichborn, 82 S., Hardcover, farbig,
Euro 19.95 / sFr. 30.50
|
|
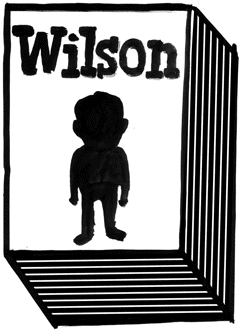
«Wilson»
|
| |
|
|
Held und Hase im Wunderland
ach zehn Jahren kehrt ein Mann aus dem Exil in die Heimat zurück, auf das Estrama-Archipel in den Antillen. Vorgeblich als Architekt mit dem Auftrag, eine Kirche zu renovieren. Was aber sucht er wirklich? Arbeit oder Absolution? Er ist ein merkwürdiger Mann. Nicht wirklich fassbar. Fein gekleidet im Anzug bedeckt er sein Gesicht mit einer schwarzen Hasenmaske. Schwül, tropisch und verschwommen wirkt auch die Insel Estrama, wo ein karnevaleskes Spiel mit Masken und Fassaden die Politik bestimmt. Allgegenwärtig macht sich Aufruhr bemerkbar, ein Volksaufstand steht bevor.
Die Erinnerung quält den maskierten Mann, seine Vergangenheit konfrontiert ihn mit surrealen Eindrücken, durch die er sich vortastet wie Alice im Wunderland. Zugleich wird er von der realen Revolution überrollt, durch die er sich kämpft wie ein Superheld aus dem Marvel-Universum.
Der 1981 geborene Zeichner, Mathematiker und Architekt Akalikoushin zeigt wenig Scheu, unterschiedliche Stile eigenhändig zusammenzuführen. Er wolle sich nicht auf eine bestimmte Technik beschränken, sagt er, sondern jeweils die passende Technik nutzen, um einen Gedanken, ein Gefühl oder eine Handlung auszudrücken. In «Carnaval» verwendet er dunkle, blaue, schwarze und braune Aquarellfarben.
Seine Figuren erinnern an verschiedene Genres: Der Mann mit der Maske eines schwarzen Hasen würde in Frank Millers «Sin City» genauso eine gute Figur machen wie in Alex Maleevs «Daredevil» oder als Weggefährte von Hugo Pratts Corto Maltese. Lose auf einer Revolte 1967 in Guadeloupe aufbauend, ist «Carnaval» eine fiktive Erzählung, die Elemente des Politthrillers mit Fantasy und magischem Realismus aufmischt. Ob die Fäden, die im ersten Band der Tetralogie ausgelegt werden, zu einem schlüssigen Ende führen, bleibt abzuwarten.
Ambitioniert ist auch die Verlegerstrategie der «gemeinschaftlichen» Edition Manolosanctis, die 2009 von drei französischen Hochschulabgängern gegründet wurde: Auf einer Internet-Plattform können Zeichnerinnen und Zeichner ihre Entwürfe veröffentlichen, austauschen und kommentieren. Die Präferenzen der Internetgemeinschaft beeinflussen das Buchprogramm. Über 800 Autorinnen und Autoren haben nach Angaben des
Verlags die Plattform bisher genutzt, 15 Alben wurden gedruckt.
Florian Meyer
Akalikoushin:
«Carnaval Tôme 1: Le retour de l’homme qui portait un masque de lapin noir».
Manolosanctis, 80 S., Hardcover, farbig,
Euro 16.50 / ca. sFr. 28.–
www.manolosanctis.com/akalikoushin
|
|
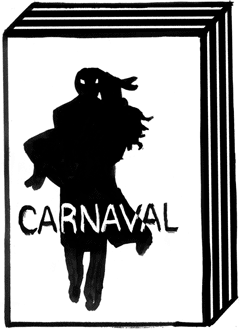
«Carnaval Tôme 1: Le retour de l’homme
qui portait un masque de lapin noir»
|
| |
|
|
Ein merkwürdiger Hergé –
«X’ed Out» von Charles Burns
Nach Fertigstellung seines preisgekrönten Opus magnum «Black Hole» wird sich Charles Burns wohl gefragt haben, wie es nun weitergehen soll. Stand er doch an einem Punkt seiner Karriere, an dem er all die Unannehmlichkeiten der Pubertät, die Faszination von Zerfall und Mutation und die gruseligen Freuden von B-Horrorfilmen zur Genüge erforscht und beschrieben hatte.
Was nun? Noch mehr vom gleichen, aber noch skurriler. «X’ed Out», das als «erster Teil eines epischen Meisterwerks zeichnerischer Fiktion» beworben wird, zeigt uns Doug, einen ziemlich durchschnittlichen Vororts-Teenager mit schwerwiegenden Hirnschäden, der auf starke Schmerzmittel abfährt und übles Zeug zusammenträumt. Doug führt ein illustriertes Tagebuch, kämpft mit seiner zerrütteten Familie, möchte Performance-Künstler werden und wandert nachts – wach oder schlafwandelnd? – als eine Art verwirrter Tintin durch eine post-apokalyptische Welt.
Genau, Tim und Struppi! Burns lässt keinen Zweifel daran, dass er sich auf den belgischen Reporter und Bande-dessinée-Archetypus bezieht, wenn er den Umschlag von «X’ed Out» demjenigen von Hergés Album «Der geheimnisvolle Stern» nachempfindet, die arktische Landschaft ersetzt durch Chaos und Ruinen, den Pilz durch ein rot geflecktes Ei. Doug tritt an seinen nicht sehr erfolgreichen Kunstperformances (sein Publikum steht eher auf Punkrock als auf Gedichte) mit einer Tim-Maske verkleidet auf, und in seinem Schlafzimmer sehen wir die Tim-Alben im Regal stehen.
Nachdem ich «X’ed Out» nun drei Mal gelesen habe, weiss ich noch immer nicht genau, worauf Burns mit diesem Buch abzielt. Die Geschichte ist nicht so sehr Hergé als William S. Burroughs, auf den sich Burns insofern bezieht, als er Doug in seinen Performances Cut-up-Gedichte von Burroughs rezitieren lässt. Aber vielleicht geht es in Burns Buch vor allem um Form und Stil, um Queneau’sche Stilübungen, darum, herauszufinden was geschieht, wenn er die Comic-Ikone Tim Burroughs dadaistischen Methoden von Cut-up und automatischem Schreiben unterwirft. Wie immer verwendet Burns all seine bevorzugten Themen und Bilder: verfaultes Fleisch, Albträume, Würmer mit Gesichtern, ekelhaftes Essen, attraktive, bekloppte Mädchen und aggressive Aliens. Zwar macht die Geschichte nicht wirklich Sinn, aber was soll’s? Oft werden narrative Comics sowieso überschätzt, und «X’ed Out» bringt den Leser dazu, sich aus den Einzelteilen seine eigene Geschichte zu basteln.
Das Buch ist eine Augenweide – der Verlag Pantheon hat es als Luxus-Hardcover-Ausgabe im europäischen Albumformat herausgegeben, mit einem roten Textil-Buchrücken und in bester Qualität gedruckt, durchgehend vierfarbig, was ausgezeichnet zu Burns’ gewohnt tiefschwarzen Pinselstrichen passt.
Jasper Johns, der berühmte amerikanische Kunstmaler, sagte einst über seine kreative Arbeit: «Mach etwas. Dann füg etwas dazu. Und dann füg wiederum etwas dazu.» Charles Burns weiss als reifer Comic-Zeichner sehr genau, welchen Weg er mit seinen Comics eingeschlagen hat, und diesen Weg geht er nun weiter. Vielleicht sind gewisse Leser enttäuscht von seiner Entscheidung, nichts radikal anderes zu versuchen. Wenn man aber das bestechende Resultat seiner Bestrebungen sieht, auch in diesem Buch wieder übelste Schrecken und mitreissende Langeweile zu evozieren, wäre es höchst unfair, sich zu beklagen. Mark
David Nevins
Charles Burns: «X’ed Out».
Pantheon Books, nicht paginiert, Hardcover, farbig,
US$ 19.95
|
|
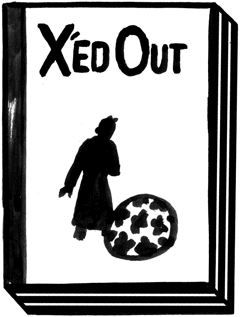
«X’ed Out».
|
| |
|
|
Suburbane Einsamkeit
Es muss die Kindheit auf den Falkland-Inseln gewesen sein, welche einen prägenden Einfluss auf das noch junge Werk von Jon McNaught hatte. In seinen beiden kurz nacheinander erschienenen Büchern «Birchfield Close» und «Pebble Island» kommt der englische Illustrator und Autor immer wieder auf die Themen Kindheit, Langeweile und Schönheit der Natur zurück. Eine Landschaft aus kleinen identischen Wohnhäusern dominiert den Buchumschlag von «Birchfield Close». In dieser Kurzgeschichte versuchen zwei Jugendliche, dieser suburbanen Ödnis zu entfliehen. Auf einem Hausdach sitzend, suchen sie in der Landschaft vorfabrizierter Häuslichkeit nach Unterhaltung. In einem kleinen visuellen und auditiven Trip eröffnen sich ihnen Bilder und Geräuschkulissen eines ereignislosen sommerlichen Sonntagnachmittags: vorbeiziehende Autos, Musik und Gesprächsfetzen aus Radio- und Fernsehgeräten in der Nachbarschaft, Paare, die im Garten ein Sonnenbad nehmen. Und immer wieder kreuzt die Hässlichkeit der künstlichen Wohnlandschaft die Schönheit der Natur; Wolkenformationen, vorbeiziehende Vogelschwärme, das Abendrot. So simpel und schön McNaught diese bukolischen Miniaturen zeichnet, die Natur scheint hier Opfer der menschlichen Besetzung zu sein.
Anders bei seinem zweiten Buch «Pebble Island». Hier diktiert die Natur den Alltag auf der dünn besiedelten Falkland-Insel. Die Sehenswürdigkeiten beschränken sich auf einen kleinen Flughafen, einen Nahrungsmittelladen, eine am Strand liegen gelassene Waschmaschine und ein paar wenige Wohnhäuser. Auch hier sind die Protagonisten Kinder, die belanglosen Tätigkeiten nachgehen. Und auch hier ist die Natur, so schön sie auch scheinen mag, von wenig Interesse für die Bewohner: Der Blick auf die vom Vollmond beleuchtete Meereslandschaft vermag einen der Protagonisten nur kurz zu bannen, bevor er sich wieder seiner Fernsehsendung widmet.
Die Einsamkeit, die Langeweile und die Stille, von denen Jon McNaughts Geschichten erzählen, werden durch seine wortlosen Bilder verstärkt (die einzigen zu lesenden Kommentare stammen aus den Filmen am Fernsehen). Die Handlungen der Menschen und die Landschaftsbilder sprechen für sich allein, wodurch der junge Engländer ein wenig an seinen amerikanischen Kollegen Chris Ware erinnert.
Giovanni Peduto
Jon McNaught: «Birchfield Close».
Nowbrow Press, 38 S., Hardcover, dreifarbig,
Euro 12.– / US$ 16.–
«Pebble Island».
Nowbrow Press, 38 S., Hardcover, vierfarbig,
Euro 12.50 / US$ 16.50
|
|

«Pebble Island»
|
| |
|
|
Haarmann
ritz Haarmann gilt als einer der brutalsten Serienmörder in der Kriminalgeschichte. 1924 wurde er für die Morde an 24 Jungen im Alter von 10 bis 22 Jahren verurteilt und erhielt Beinamen wie «Der Vampir», «Der Werwolf» oder «Der Schlächter von Hannover». In «Haarmann» setzen sich die Comic-Zeichnerin Isabel Kreitz und der Autor Peer Meter mit der Frage auseinander, warum der Massenmörder über all die Jahre unentdeckt geblieben ist. Peer Meter arbeitete bereits mit Barbara Yelin zusammen an dem Comic «Gift» über die Serienmörderin Gesche Gottfried.
In der nun vorliegenden, fesselnden Geschichte nähert sich das Duo dem Psychogramm Haarmanns und liefert darüber hinaus ein differenziertes Sittenbild der damaligen Gesellschaft. Die Wirtschaft Deutschlands lag aufgrund der Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg darnieder, die galoppierende Inflation und hohe Arbeitslosigkeit sorgten für soziale und politische Unruhen, die Nährboden für politische Extremisten waren. Die instabilen gesellschaftlichen Verhältnisse wusste der Kleinkriminelle Haarmann geschickt für seine mörderischen Taten zu nutzen. Obwohl er 17 Verurteilungen wegen Unterschlagung, Diebstahl und Hehlerei aufzuweisen hatte und ihm Schizophrenie attestiert wurde, verfügte er über einen Ausweis der Polizei, da er für diese als Spitzel tätig war. Unter dem Vorwand, Ermittlungen vorzunehmen, sprach Haarmann jugendliche Ausreisser auf dem Bahnhof an. Er lud sie ein, bei ihm zu Hause zu übernachten, wo er sie vergewaltigte und dann im Rausch mit einem Biss in den Hals tötete. Die Körper der Opfer zerstückelte er und verkaufte ihr Fleisch und ihre Kleidung an ahnungslose Nachbarn und Freunde. Die Knochen entsorgte er im Fluss Leine, in dem 1924 über 200 Knochenteile entdeckt wurden, die mindestens 22 Personen zugeordnet werden konnten. Um die Verstrickungen der Polizei mit Haarmann sowie eklatante Ermittlungsfehler zu vertuschen, versuchte man, ihn möglichst schnell zum Tode zu verurteilen und erpresste unter Gewaltanwendung ein Geständnis.
Nach «Die Sache mit Sorge» widmet sich Kreitz erneut einer historischen Figur, deren Biografie eine korrumpierte Gesellschaft widerspiegelt. Kreitz’ realistische Bleistiftzeichnungen liefern das passende Setting für die schauerliche Kriminalgeschichte, in der sowohl Normalbürger als auch Staatsgewalt jegliche moralischen Werte vermissen lassen. Virtuos setzt sie extreme Perspektivenwechsel dramaturgisch pointiert ein und verleiht dieser Erzählung eine atemberaubende bildliche Dynamik.
Matthias Schneider
Isabel Kreitz und Peer Meter: «Haarmann».
Carlsen Verlag, 176 S., Hardcover, s/w,
Euro 19.90 / sFr. 31.50
|
|

«Haarmann»
|
| |
|
|
Hollywood
Der Illustrator und Grafiker Robert Nippoldt erhielt bereits für sein Buch «Jazz im New York der wilden 20er Jahre» den Preis «Schönstes Buch des Jahres 2007». Seine aktuelle Publikation «Hollywood in den 30er Jahren» ist ein sicherer Anwärter auf den diesjährigen Buchpreis, denn Nippoldt ist erneut eine bibliophile Preziose gelungen, die ihresgleichen sucht. Allein die drucktechnische Umsetzung des Buches ist ausserordentlich. Wie ein Vorhang verhüllt der goldene, siebbedruckte Leineneinband die zahlreichen Anekdoten aus Hollywood von denen dieses Werk handelt. Auf den ersten Seiten wird eine Filmpremiere in L.A. dargestellt, der Kinopalast ist hell erleuchtet, Limousinen fahren vor und Stars schreiten über den roten Teppich. Im Kinosaal öffnet sich der Vorhang und die Traumwelt Hollywood stellt ihre interessantesten Protagonisten vor. Schauspielstars wie James Cagney, Cary Grant, Buster Keaton und Marlene Dietrich werden in Portraits und ausgewählten Filmszenen präsentiert, mit all ihren glamourösen Seiten, aber auch spleenigen Besonderheiten, von Jean Harlows wanderndem Schönheitsfleck bis hin zu den Skandalen eines Errol Flynn. Die ausgiebige Recherche, die Nippoldt für dieses grossartige Buchprojekt betrieben hat, tritt vor allem bei den Portraits über weniger populäre Mitstreiter des Hollywood-Business zu Tage. Es wird sowohl dem legendären «Freaks»-Regisseur Tod Browning die Ehre erwiesen als auch dem Maskenbildner Jack Pierce, der Frankenstein ein Gesicht gab. Für die fachkundigen Texte, in denen er unterhaltsam Hintergrundinformationen und Anekdoten aus den diversen Schmökern der Filmgeschichte miteinander verwebt, zeichnet der Filmkritiker Daniel Kothenschulte verantwortlich. «Hollywood in den 30er Jahren» ist ein bibliophiles Gesamtkunstwerk, das dank Kothenschultes Textbeiträgen und Nippoldts realistischer Illustrationen sowie liebevoller Buchgestaltung gleichermassen zum Betrachten und Lesen, zum Entdecken und Stöbern einlädt. Am Ende des Buches erscheint wie im Film ein Abspann mit den Namen aller Mitwirkenden, ohne die das Werk nicht realisierbar gewesen wäre. Doch nach dem Film ist vor dem Film. Denn Nippoldts Publikation lässt die legendäre Filmepoche wieder aufleben und lädt uns dazu ein, viele weitere Klassiker der Filmgeschichte neu zu entdecken.
Matthias Schneider
Robert Nippoldt und Daniel Kothenschulte: «Hollywood in den 30er Jahren».
Gerstenberg Verlag, 160 S., Hardcover, s/w,
Euro 39.95 / sFr. 56.90
|
|
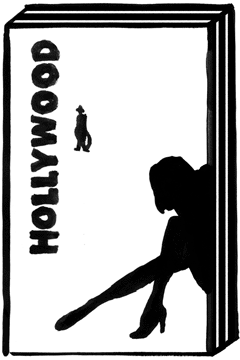
«Hollywood in den 30er Jahren»
|
| |
|
|
Bulle mit Biss
In den USA ist die 2009 von John Layman und Rob Guillory begonnene Reihe «Chew» bereits ein grosser Erfolg: 2010 wurden ihr der Eisner- wie auch der Harvey-Award für die beste neue Serie verliehen, und Guillory erhielt gleichzeitig den Harvey-Award als bestes Neutalent. Nun ist auch die deutschsprachige Ausgabe erschienen, wobei der erste Band, «Leichenschmaus», die ursprünglich separat erschienenen Teile 1 bis 5 enthält.
«Chew» ist im Grunde eine Kriminalgeschichte, die jedoch zwei ungewöhnliche Elemente enthält: Zum einen spielt die Handlung in einer nahen Zukunft, in welcher die USA nach einer weltweit grassierenden Vogelgrippe mit Millionen von Todesopfern ein Geflügel-Verbot eingeführt haben. Zum anderen – und hier wird es wirklich abgefahren – besitzt der Protagonist Tony Chu eine äusserst spezielle Gabe, die sich Cibopathie nennt: Wenn er etwas isst, löst der Geschmack bei ihm eine detaillierte Vorstellung davon aus, was mit dieser Speise vorher geschehen ist, also wie sie hergestellt wurde, wer sie wie behandelt hat usw. So sieht er beispielsweise bei einer Frucht, wie sie geerntet, oder bei einem Tier, wie es geschlachtet wurde. Als die FDA (Food and Drug Administration) davon erfährt, heuert sie ihn für ihre Sondereinheit an, die besonders ungewöhnliche Mordfälle aufklärt. Denn: Cibopathie funktioniert auch mit menschlichem Fleisch, so dass Chu durch das Essen von Teilen einer Leiche den Mörder identifizieren kann. Fortan muss er für seinen Boss im besten Fall von Hühnersuppen oder alten Hamburgern kosten, im schlimmsten Fall von menschlichen Fingern oder Füssen.
Man mag es schon erahnen – eklige Details bleiben einem bei der Lektüre nicht erspart. Diese werden noch dazu durch die Farbgebung unterstützt, die vor allem zwischen grün, grau und braun pendelt und den Bildern quasi einen verwesenden Charakter verleiht. Gleichzeitig aber steckt in Laymans Dialogen wie auch in Guillorys Darstellung der Figuren viel Witz. Ausserdem sind die einzelnen Geschichten rasant und spannend erzählt und verfügen über überraschende Wendungen. Man kann «Chew» auch als Gesellschaftssatire oder Kritik an unserer Ess-Kultur lesen. Man muss aber nicht, und tatsächlich wird auch an keiner Stelle eine eindeutige Message herausgestellt. Deshalb funktioniert «Chew» auch einfach als originelle Hard-Boiled-Detektivgeschichte, die beste Unterhaltung bietet. Zugegeben: Ein Faible für schwarzen Humor und einen starken Magen muss man dafür schon mitbringen.
Jan Westenfelder
John Layman & Rob Guillory: «Chew – Bulle mit Biss 1: Leichenschmaus».
Cross Cult, 128 S., Hardcover, farbig,
Euro 16.80 / ca. sFr. 26.–
|
|
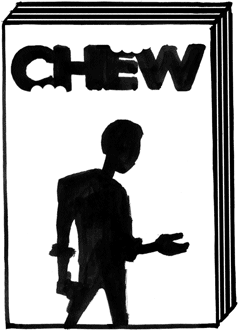
«Chew – Bulle mit Biss 1: Leichenschmaus»
|
| |
|
|
Unendliche Weiten
Der Argentinier Juan Giménez dürfte vor allem als Zeichner der «Meta-Barone» bekannt geworden sein, einer von Alejandro Jodorowsky geschriebenen Science-Fiction-/Fantasy-Serie, die im französischen Original von 1992 bis 2003 erschienen ist. Neben diversen anderen Kollaborationen mit Autoren hat Giménez aber immer auch schon selbst geschrieben, so die beiden Bände seiner Serie «Leo Roa», die ursprünglich
1988 bzw. 1991 publiziert wurden. Erst 2006 fasste der französische Verlag Les Humanoïdes Associés die beiden Geschichten in einem Band zusammen, und der Bielefelder Splitter Verlag hat sich nun auch der deutschsprachigen Ausgabe angenommen.
«Leo Roa» spielt in der Zukunft, und der gleichnamige Protagonist ist ein Journalist, der während seiner Recherchen in die skurrilsten Abenteuer verwickelt wird, die ihn durch Raum und Zeit führen. Roa ist dabei ein durchaus liebenswerter, allerdings auch etwas unbedarfter Charakter, der oft ein bisschen durch die Geschichten stolpert und sie häufig mehr durch Zufall als durch Geschick zu einem guten Ende bringt. In «Die wahrhaftige Geschichte von Leo Roa» legt er sich mit einer Horde Weltraum-Piraten an, wohingegen er in «Die Odyssee widriger Umstände» dabei hilft, eine ausserirdische Rasse vor dem Untergang zu bewahren. Nebenbei erlebt er – eher unfreiwillig – auch die ein oder andere erotische Eskapade.
Die Handlung steckt voller fantastischer Einfälle, bietet immer wieder Überraschungen und wird zudem mit viel Humor erzählt. Giménez’ Zeichnungen muten mitunter zwar etwas altmodisch an, können mit ihrem Detailreichtum ansonsten aber nur als meisterhaft bezeichnet werden. Die Bilder zu betrachten, ist gerade auch dank des grosszügigen Formats des Bandes von 23 x 32 cm ein wahrer Genuss. Für Giménez-Fans ist «Leo Roa» natürlich sowieso ein Muss, aber auch Science-Fiction-Liebhaber werden ihre Freude daran haben.
Jan Westenfelder
Juan Giménez: «Leo Roa».
Splitter Verlag, 112 S., Hardcover, farbig,
Euro 19.80 / ca. sFr. 30.–
|
|
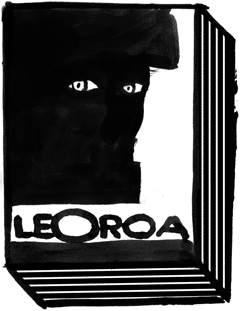 «Leo Roa» |