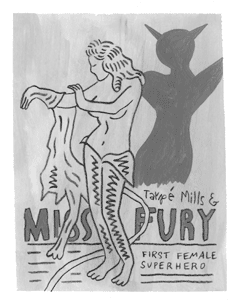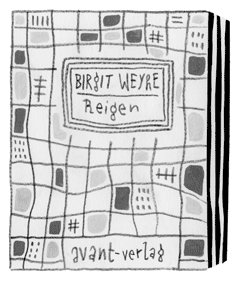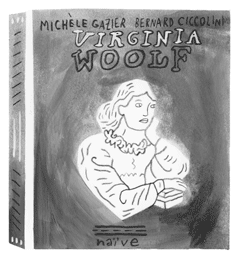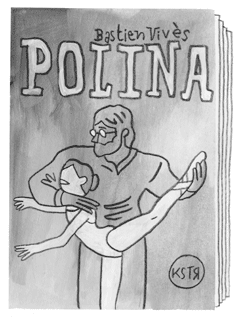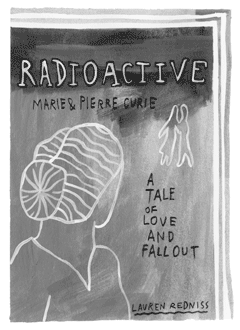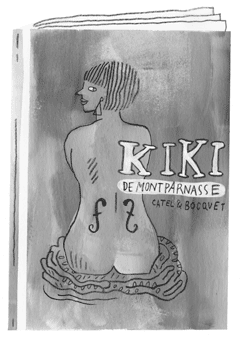|
 |
 |
Feministischer Klassiker
Als die männlichen amerikanischen Superhelden während des Zweiten Weltkriegs gegen Nazideutschland in die Schlacht zogen, Hitler symbolisch vermöbelten (Captain America) oder vor ein Gericht des Völkerbundes stellten (Superman), blieben die Frauen in den Vereinigten Staaten zurück. Sowohl die realen Frauen wie auch die weiblichen Charaktere im Comic, von denen in den 1940ern zwar nicht viele, dafür jedoch umso eindrucksvollere Beispiele entstanden. Etwa Miss Fury, die erste weibliche Superheldin, die von einer Frau, June Tarpé Mills, entwickelt und gezeichnet wurde (obwohl Mills – wie ihre Zeitgenossin Dale (Dalia) Messick, Zeichnerin von Brenda Starr – auf Druck ihres Verlegers ihre weibliche Identität durch einen geschlechtlich nicht deutbaren Namen verschleiern und sich Tarpe Mills nennen musste).
In dem zunächst noch unter dem Namen «Black Fury» publizierten Comic geht die leicht gelangweilte, wohlhabende Erbin Marla Drake in einem schwarzen Leopardenfell, das ursprünglich bei spirituellen Zeremonien eines afrikanischen Medizinmanns zum Einsatz kam und mysteriöse übernatürliche Kräfte verleiht, ab 1941 als Miss Fury auf Verbrecherjagd. Und während ihre männlichen Kollegen in Europa mit der Nazi-Herrschaft aufräumen, bekommt es Miss Fury mit nach Amerika geflohenen Nationalsozialisten zu tun: Ihre Erzfeindin ist eine Adelige mit dem bedeutsamen Namen Baroness Erika von Kampf, die bis Ende der Vierziger immer wieder in den Strips auftaucht und ebenso wie der zwielichtige deutsche General Bruno von Miss Fury in die Schranken gewiesen werden muss. Nebenbei: Wer wissen will, woher Quentin Tarantinos Idee aus «Inglorious Basterds» stammt, gefangene Nazis mit einem Hakenkreuz auf der Stirn zu markieren, damit ihre Täterschaft sichtbar bleibt, dem sei Miss Fury ebenfalls ans Herz gelegt: Ein solches Hakenkreuz auf der Stirn trägt unfreiwillig Erika von Kampf. Die Episode, in der sie dieses eingebrannt bekommt, ist in dem edel aufgemachten und von Trina Robbins edierten Sammelband aller Miss-Fury-Sonntagsstrips zwischen 1944 und 1949 leider nicht enthalten. Dafür wird der Leser mitten hineingeworfen in das komplizierte Leben Marla Drakes, ihre Männergeschichten sowie Auseinandersetzungen mit Erika von Kampf und General Bruno.
Nachdem die Reihe 1951 eingestellt wurde, ist sie schnell in Vergessenheit geraten, nun ist der Klassiker der feministischen Comic-Geschichte in einer aufwändigen Suche in diversen Zeitungs- und Universitätsarchiven, Bibliotheken und privaten Sammlungen auf zwei Kontinenten annähernd vollständig (einige Sonntagsstrips waren nur noch in Schwarzweiß aufzufinden) rekonstruiert und mit allerlei Bonusmaterial – etwa der unvollendeten Graphic Novel «Albino Jo, the Man with Tiger Eyes» und einer Einführung ins Leben und Werk von June Tarpé Mills – versehen worden.
Jonas Engelmann
Tarpe Mills: «Miss Fury». Sensational Sundays 1944–1949.
IDW Publishing, 234 S., Hardcover mit Schutzumschlag, s/w & farbig,
$ 49.99
|
| Cover-Illustrationen von
Lea Heinrich
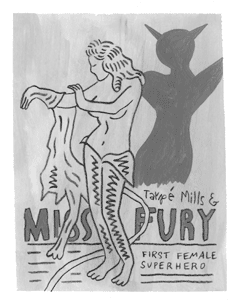
«Miss Fury» |
| |
|
|
Aneignungen
«Marie» steht eingraviert auf der Rückseite einer Taufkette mit dem Abbild der Jungfrau Maria, die zur symbolischen Protagonistin in Birgit Weyhes Debüt «Reigen» wird. Über die Weitergabe der Kette werden in zehn Episoden mal mehr, mal weniger wichtige Ereignisse und Themen des 20. Jahrhunderts miteinander in Verbindung gebracht: der Erste und Zweite Weltkrieg, der Luftkrieg der Alliierten, frankokanadische Separationsbestrebungen, aber auch politische Hoffnung und Repression in Kenia.
Lose angelehnt an Arthur Schnitzlers Drama «Reigen» bilden die über die Taufkette miteinander verbundenen Episoden einen Kreislauf, der von den Kriegswirren des Ersten Weltkriegs bis in die Gegenwart des Jahres 2011 reicht und sich – ähnlich wie bei Schnitzler – durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht: Die französische Fabrikarbeiterin (und spätere Résistance-Kämpferin) Lucille Dubois oder der kenianische Bootsjunge Samuel Wafula sind ebenso kurzzeitige Besitzer der Kette wie die aufstrebende Jungakademikerin Marie Laurent. Letztere stellt sich als die Urenkelin der ersten Besitzerin der Kette, Marie Boivin, heraus, womit sich der Reigen schließt.
Während Schnitzlers Drama 1920 einen Theaterskandal auslöste, weil die Sexualität, das Verhältnis von Macht und Verführung, im Mittelpunkt stand, kann Birgit Weyhes Wahl – statt Körperflüssigkeiten die Jungfrau Maria von Personenkonstellation zu Personenkonstellation weiterzugeben – als eine ironische Aneignung Schnitzlers gelesen werden. Neben der ironischen Bezugnahme auf Schnitzlers Drama als Rahmen von Weyhes «Reigen» sind in einzelnen Episoden Zitate von wegweisenden Comics zum jeweils angeschnittenen Thema versteckt; so fühlt man sich bei den Bildern des Ersten Weltkrieges des Öfteren an die Arbeiten Tardis erinnert, während anderswo das Setting einer Episode, die das Verhältnis der in einer lesbischen Beziehung lebenden Marie Laurent zu ihrem Vater beschreibt, an die Vater-Tochter-Beziehung in Alison Bechdels «Fun Home» zu zitieren scheint. Auch wenn die Art, wie die Episoden über die Weitergabe der Kette miteinander verknüpft werden, manchmal ein wenig konstruiert wirkt, bleibt «Reigen» eine kurzweilige Lektüre, die gerade durch das breite Feld an Themen immer spannend bleibt. Die variantenreichen Schwarzweiß-Zeichnungen passen sich subtil den Lebensumständen und Persönlichkeiten der jeweils die Episode bestimmenden Protagonisten an, über deren Leben man in einigen Fällen gerne mehr erfahren hätte.
Jonas Engelmann
Birgit Weyhe: «Reigen».
avant-verlag, 234 S., Softcover, s/w,
Euro 19.95 / sFr. 27.80
|
|
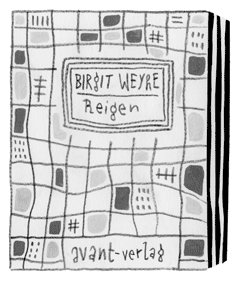 «Reigen»
|
| |
|
|
Flüchtlingsschicksal «mit alles»
Am Schluss fragt man sich etwas ratlos, was einem Judith Vanistendael auf den knapp 150 Seiten von «Kafka für Afrikaner. Sofie und der schwarze Mann» eigentlich erzählen wollte. Die Liebesgeschichte zwischen Sofie und dem Asylbewerber Abou? Den Konflikt zwischen Sofie und ihren Eltern? Wollte sie die Bereicherungen und Schwierigkeiten einer interkulturellen Beziehung schildern? Die europäische Einwanderungs- und Ausschaffungspolitik und den Widersinn der belgischen Bürokratie anprangern? Oder ein bisschen «mit alles»?
Der Plot ist rasch zusammengefasst: Sofies Eltern fragen sich, warum ihre 19jährige Tochter so viel Zeit in einem Asylbewerberheim verbringt – bis diese ihnen Abou vorstellt. Da die belgischen Behörden dem Prinzen aus Togo die Foltergeschichte nicht abnehmen, bleibt dem Paar nach vielen bürokratischen Hürden und Fallen nichts anderes übrig als die Heirat, in welche die Eltern – durch die Umstände anfangs befremdet, dann zusehends nett und weltoffen – schließlich einwilligen.
Keine Frage, das ist der Stoff für eine interessante, packende und wichtige Geschichte. Ein gutes Thema allein ist jedoch längst noch keine gute Geschichte, und das ist das Problem von «Kafka für Afrikaner». Vanistendael gelingt es nicht, die Handlungsfäden, Figuren und Konflikte überzeugend zu verknüpfen. Man weiß nie so recht, welche Geschichte gerade erzählt wird und wer der entscheidende Handlungsträger ist. Abou? Sofie? Ihr Vater? Die Versuchung, ein bisschen alles ansprechen zu wollen, führt so zu einer unangenehmen Oberflächlichkeit: Wir erfahren kaum etwas über die Gefühle zwischen Sofie und Abou und ebenso wenig über ihren Alltag; der Konflikt zwischen Eltern und Tochter, aber auch der Sinneswandel der Eltern wird kaum reflektiert und das Verhalten der Festung Europa gegenüber Flüchtlingen aus dem Süden nur gestreift. So wird man den Figuren und ihren Beziehungen gegenüber je länger, je gleichgültiger bis man schließlich im Epilog erfährt, dass sich Sofie bereits ein Jahr später vom exotischen Gatten getrennt und mit einem soliden Belgier eine Familie gegründet hat. Die Dämonen, die Abou verfolgten, so ihre einzige (und unbefriedigende) Erklärung, seien ihr zu mächtig geworden.
So bleibt nach dem Zuklappen von «Kafka für Afrikaner» ein schaler Nachgeschmack: Im aktuellen Graphic-Novel-Hype reicht heute offensichtlich das «gute» Thema aus, um ungeachtet anderer Qualitäten erfolgreich veröffentlicht zu werden. Das ist schade für das dringliche Thema. Und frustrierend für die Leser.
Christian Gasser
Judith Vanistendael: «Kafka für Afrikaner. Sofie und der schwarze Mann».
Reprodukt Verlag, 152 S., Klappenbroschur, s/w,
Euro 20 / sFr. 26.90
|
|

«Kafka für Afrikaner. Sofie und der schwarze Mann»
|
| |
|
|
Die Wogen im Leben der Virginia Woolf
Allein der eine Satz, der die Wirkung einer Welle beschreibt und mit dem Leben eines Menschen verbindet, bleibt unvergesslich: «Die Welle hielt inne und zog sich dann wieder zurück, seufzend wie ein Schlafender, dessen Atem unbewusst kommt und geht.» Zu lesen ist er in Virginia Woolfs sechstem Roman «Die Wellen», gleich zu Beginn, wo die Nacht dem Tag weicht und eine Welle, schaumgekrönt, den Strand bedeckt und wieder freigibt. Mit einer Bildfolge von der Küste bei St. Yves in Südwestengland, in der die Wellen überfließen in die aus der Schreibfeder strömenden Gedanken, beginnt die Comic-Biografie «Virginia Woolf», welche die Autorin Michèle Gazier und der Zeichner Bernard Ciccolini verfasst haben. Erschienen ist sie in der Reihe «Grand Destins de Femmes» (dt. «Bedeutende Frauenschicksale») der französischen Éditions naïve. Entsprechend schicksalsbetonend spult sich die strikt chronologische Erzählung ab: Sie beginnt im Haushalt des Schriftstellers Sir Leslie Stephen, in dem Virginia Woolf mit sieben Geschwistern aufwächst, schildert ihren Aufstieg und zeigt, wie sie mit ihrem Ehemann, dem Literaturkritiker Leonard Woolf, den Verlag «The Hogarth Press» führt. Es ist eine bemerkenswert technikfreie Welt, die sich zwischen intellektueller Bohème und kleinadligem Landleben vollzieht, und in welcher der Tod in Form von Typhus, Tuberkulose und Grippe viel stärker präsent ist als die Weltkriege, die wie irreale Wetterleuchten am Horizont flimmern.
Gaziers einfühlsame Erzählweise macht den Comic lesenswert: Dicht und doch zurückhaltend führt sie einen ins Familienleben ein, bleibt nahe am Werk und vermeidet doch ein bloßes Bebildern literarischer Zitate. Ciccolinis reichlich hölzerne Illustrationen halten da nicht mit: Die im Vorwort versprochene Leidenschaft ist ihnen kaum anzusehen. Am meisten überzeugen kann die Kolorierung, die das Auf und Ab der zunehmend depressiven und schließlich Suizid begehenden Virginia Woolf stimmig abbildet. Für den Schrecken jedoch, den das Ehepaar Woolf in Deutschland erlebt, als es der aufgewiegelten Nazi-Masse begegnet, gibt es gewiss gewieftere Illustrationstechniken, als elfenhafte Gesichtszüge mit koboldartigen Fratzen zu kontrastieren. Alles in allem ist Gaziers und Ciccolinis «Virginia Woolf» eine gefällige Lebensgeschichte, an der alle Entwicklungen, welche die Graphic Novel in den letzten 20 Jahren durchlaufen hat, leider unbemerkt vorbeigezogen sind.
Florian Meyer
Michèle Gazier, Bernard Ciccolini: «Virginia Woolf».
Éditions naïve, 96 S., Hardcover, koloriert,
Euro 23 / sFr. 36.80
|
|
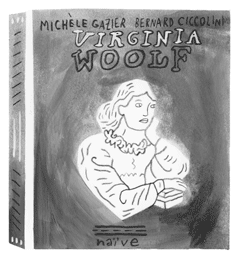
«Virginia Woolf»
|
| |
|
|
Der Weg einer Tanzschülerin zum Star
Was verbindet eine Ballettschülerin mit ihrem Lehrer? Ist es nur Erziehung und Ausbildung oder spielen auch Freundschaft, Fürsorge und Achtung eine Rolle? Diese Spannung zwischen professioneller Distanz, künstlerischer Hingabe und zwischenmenschlicher Zuneigung zieht sich durch die gesamte Graphic Novel, mit welcher der Comicautor Bastien Vivès den Werdegang der russischen Tänzerin Polina Ulinow nachzeichnet. Schon beim Eintritt in die Tanzakademie ist ihre Begabung offensichtlich, und Polina wird der Meisterklasse von Nikita Bojinski zugeteilt. Wer Bojinski anvertraut wird, macht entweder große Karriere oder gibt auf. Auch Polina droht, an der ersten Hürde zu scheitern. Tanz habe immer leicht und elegant zu wirken, egal, wie schmerzhaft die Anstrengung auch sein möge, wird Polina vom Meister belehrt, bevor dieser sie fürs Erste vom Unterricht ausschließt: «Kommen Sie erst wieder, wenn Sie es mit dem Tanzen ernst meinen.» Polina besteht den Test und erklimmt bald die nächste Karrierestufe. Sie wechselt ins Theater. Mit dem dort gepflegten, «riskanteren» Tanzstil kommt sie jedoch schlecht zurecht. Als Polina einen Solotanz mit Bojinski einstudiert, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Choreographin des Theaters und ihrem ehemaligen Lehrer.
Polina entscheidet sich für einen dritten Weg und schließt sich der Gruppe von Michail Laptar an. Dieser charismatische Choreograph macht sie mit dem experimentellen Tanz vertraut. Eine Aussprache mit Bojinski lehnt sie ab. Als sie sich am Knöchel verletzt und eine Hauptrolle verliert, gibt Polina ihrer Karriere nochmals eine Wende und bricht nach Berlin auf. Erst nach Jahren, als sie längst zu einem Star des Solotanzes aufgestiegen ist, trifft sie ihren Lehrer wieder, und die Begegnung ist gezeichnet von gegenseitiger Achtung, aber auch von der Enttäuschung, dass sie sich nie zu einem gemeinsamen Projekt haben durchringen können. Vivès schildert Polinas Werdegang ziemlich unprätentiös: Seine hauchfeinen, schwarzweißen Zeichnungen schmiegen sich der Leichtigkeit des Tanzes an und behalten zugleich durch einen erdigbraunen Grundton die Bodenhaftung. «Der Tanz ist eine Kunst. Es gibt keine Gegner und keine Partner», heißt es an einer Stelle, und die Ambivalenz, die sich zwischen der Eleganz des Tanzes und der Härte des Wettbewerbs aufspannt, durchzieht die ganze Graphic Novel.
Florian Meyer
Bastien Vivès: «Polina».
Verlag Reprodukt, 208 S., Softcover, zweifarbig,
Euro 24 / sFr. 33.50.
|
|
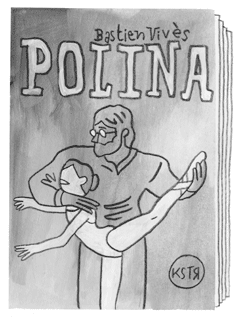
«Polina»
|
| |
|
|
Strahlende Liebe – Das Leben der Madame Curie
Vor ein oder zwei Jahrzehnten beschäftigte ich mich mit dem poetischen Potenzial von Comics. Die Achtziger und Neunziger waren eine Zeit, in der sehr viel mit neuen Formen experimentiert wurde, Autobiografien waren gerade en vogue, viele Zeichner begannen, sich mit Reportage-Comics zu beschäftigen. Meisterwerke entstanden – wie z.B. Saccos «Palästina», Spiegelmans RAW-Magazin oder die wunderbaren Bücher von Marc-Antoine Mathieu – und kleine Verlage wie Amok/Freon oder L’Association ließen sich von eleganten Literaturmagazinen und der Kunstwelt inspirieren. Aber wo, fragte ich mich, blieb die Poesie? Gab es denn keine Möglichkeit, Comic und Poesie zu verschmelzen? Sollten die beiden Formen tatsächlich inkompatibel sein? Und wieso wagte keiner wenigstens einen Versuch?
Dann erschien Lauren Redniss’ «Radioactive» und damit ein verblüffendes Beispiel von Comic-Poesie. Nicht, dass das Buch in Versform geschrieben wäre; ganz im Gegenteil, es kommt eher prosaisch daher, auch wenn es sich sehr leicht liest. Eigentlich ist das Buch nicht einmal ein richtiger Comic, da es weder Panels noch Sprechblasen aufweist. Trotzdem besitzt es eine zutiefst poetische Empfindsamkeit, denn die Autorin hat ein subtiles Ohr für die Sprache und einen selbstbewussten Umgang mit Feder, Farbe und Komposition. Es ist nicht vermessen zu sagen, dass Redniss sowohl mit Poesie als auch mit Comics meisterlich umzugehen versteht.
«Radioactive» ist die Biografie von Marie Curie, ihres Zeichens nicht nur die erste weibliche Nobelpreisträgerin, sondern auch der erste Mensch, der zwei Mal den Nobelpreis gewann (einmal in Physik und einmal in Chemie). Das Album ist aber auch eine ausführliche Geschichte über die Erforschung der Radioaktivität und ihrer Auswirkungen auf unser Leben. Sei es als Energiequelle, als Heilmittel gegen Krebs oder als Massenvernichtungswaffe mit dem Potenzial, menschliches Leben für immer auszulöschen. «Radioactive» erinnert mich an W. G. Sebalds beste Werke, es behandelt allgemeine geschichtliche Themen anhand genauer Beobachtungen und philosophischer Überlegungen, überlässt es aber dem Leser, Schlussfolgerungen zu ziehen. Tatsächlich lässt einem die Geschichte nicht so schnell los – auch dies eine Eigenschaft qualitativ hochstehender Gedichte. So nimmt Redniss zum Beispiel den Moment des frühen Todes von Pierre (Maries Ehemann) zum Anlass, den Unfall in Tschernobyl und seine Nachwirkungen zu behandeln.
«Radioactive» ist nicht nur äußerlich ein wunderschönes Buch, sondern auch eine wunderbare poetische Collage, voll toller Ideen; tragische geschichtliche und biografische Aspekte wechseln ab mit originellen und verschrobenen humoristischen Einfällen. Redniss hat keinen Recherche-Aufwand gescheut, und auch die Teile des Buches, die sich mit seriösen wissenschaftlichen Fakten beschäftigen, lassen sich gut lesen. Die Autorin zieht oft die reichhaltigen und detaillierten Tagebücher der Curies heran, zitiert häufig direkt daraus, was wiederum einen poetischen Effekt auf verschiedenen Ebenen erzeugt. Zudem beschert sie uns eine Fülle von selbst gefundenem historischen Material, ein Interview mit einem Wissenschaftler, der die Folgen radioaktiver Katastrophen auf die Umwelt untersucht, sowie mit einer Frau, die als junges Mädchen den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima miterlebte, eine Geschichte, die wohl kein Leser so schnell vergessen wird.
Redniss’ Bilder sind genauso eindrücklich und kraftvoll wie ihre Texte. Meist sind ihre Zeichnungen in einem modernistischen Stil gehalten – Picasso, Matisse und Munch lassen grüßen – was äußerst passend ist, da durchaus Parallelen bestehen zwischen Curies Erforschung des «Zaubers» der radioaktiven Strahlung und den gleichzeitig stattfindenden Entwicklungen in Literatur und bildender Kunst. Ihre Strichzeichnungen wirken energisch, aber was noch mehr beeindruckt, ist Redniss’ Umgang mit Farbe – mutige Farbtupfer, die an Gauguin, Van Gogh und Rothko gemahnen. Einige der Seiten wurden im Lichtpausverfahren gedruckt, bei dem man mit Sonnenlicht und chemisch behandeltem Papier arbeitet, was kobaltblaue, an Röntgenaufnahmen erinnernde Bilder mit eigenartiger Leuchtkraft hervorbringt, ein Tribut an die von Marie Curie beschriebene «spontane Brillanz» von Radium.
Das preisträchtige Album ist so kraftvoll und einzigartig wie ein instabiles Isotop, und als biografische Graphic Novel ein Werk von wahrhaft strahlender Brillanz. Wer mir nicht glaubt, soll das Buch einmal im Dunkeln betrachten ...
Mark David Nevins
Lauren Redniss: «Radioactive: Marie & Pierre Curie. A Tale of Love and Fallout».
Harper Collins 2011, 208 S., Hardcover, farbig,
$ 29.99
|
|
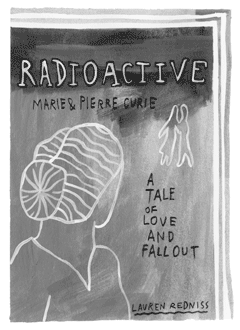
«Radioactive: Marie & Pierre Curie. A Tale of Love and Fallout»
|
| |
|
|
Sex, Drugs und Surrealismus
Es gibt wohl kaum eine andere französische Frau, um die sich so viele Mythen ranken, wie um Kiki de Montparnasse. Als bürgerliche Alice Prin wird sie 1901 unehelich in Châtillon-sur-Seine im Burgund geboren, wächst unter ärmlichen Verhältnissen bei ihrer Großmutter auf und zieht mit 12 Jahren zu ihrer Mutter nach Paris. Nachdem sie mehrere Berufsausbildungen abgebrochen hat, beginnt sie mit 14 Jahren Geld als Aktmodell zu verdienen, zunächst für einen Bildhauer, später für diverse Maler. Es ist die Geburt der mondänen und lebensfrohen Kiki de Montparnasse, dem Model, der Sängerin, Schauspielerin und Malerin, die fortan die Muse der Pariser Künstlerbohème ist. Sie geht in den Ateliers von Malern wie Moise Kisling, Tsuguharu Foujita und Per Krohg ein und aus, und zu ihrem engen Freundeskreis gehören Breton, Calder, Cocteau, Duchamp und Tzara, um nur einige zu nennen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Paris der internationale Hotspot der Avantgarde, und in Kikis Umfeld bewegen sich sowohl Ernest Hemingway und Pablo Picasso als auch Arno Breker, der spätere Haus- und Hofkünstler von Hitler. Als Muse und Modell wird Kiki zur Ikone des Surrealismus und prägt die Kunstrichtung wahrscheinlich ebenso stark wie die Künstler selbst. Bereits das Cover des über 400 Seiten dicken Comics ziert eines der berühmtesten Fotos von Kiki, es ist Man Rays legendärer Rückenakt mit den beiden aufgemalten Schalllöchern eines Cellos. Trotz ihrer beiderseitigen zahlreichen Affären hat Kiki mit dem amerikanischen Fotografen eine langjährige Beziehung. Die Zeiten des Hungers und der Armut ihrer Kindheit sind passé. Kiki singt und tanzt in den angesagtesten Clubs und ihre Malereien finden reißenden Absatz. Kiki ist auf dem Höhepunkt ihres Lebens, sie wird verehrt und gefeiert, und davon ebenso berauscht wie von ihrem exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum. Der Autor José-Louis Boucquet hat versucht, ihre turbulente und mythenreiche Biographie zu straffen, weshalb die zahlreiche Künstlerprominenz – Statisten gleich – nur kurzzeitig in Erscheinung tritt, um sodann in den angehängten biographischen Notizen zu verschwinden. Catel Mullers reduziert realistischen Schwarzweiß-Zeichnungen fördern den flotten Erzählfluss. Den Comic liest man zu Ende, bevor man ihn aus der Hand legt. Auch wenn der Comic ebenso die Schattenseiten von Kikis Ruhm und ihren späteren tiefen sozialen Abstieg beleuchtet, so ist er doch vornehmlich dem Glanz und Glamour ihrer Biographie verhaftet. Denn gegen Ende ihres Lebens ist Kiki vom Drogenkonsum aufgeschwemmt und die vermeintlichen Freunde wenden sich von ihr ab, während sie den alten Zeiten nachhängt und die Tatsache verdrängt, dass sie von der männlichen Kunstszene mehr als Objekt angesehen wurde, denn als emanzipierte Frau, die ihre Sexualität auslebt. Eine stärkere Beleuchtung der tragischen Seite von Kikis Biographie wäre dem Comic zugute gekommen, denn er hätte der Narration eine gewisse Tiefe verleihen können. 1953 kommen zur Beerdigung der einst geliebten Kiki de Montparnasse einzig ihre alten Freunde Treize, André Salmon und Foujita. Sie wurde 52 Jahre alt.
Matthias Schneider
Catel Muller, José-Louis Boucquet: «Kiki de Montparnasse».
Carlsen Verlag, 416 S., Hardcover, s/w,
Euro 36 / sFr. 44.90
|
|
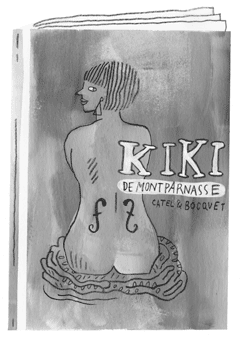
«Kiki de Montparnasse»
|
Bildergeschichte(n)
Anlässlich des 20. Jahrestags des Mauerfalls zeichnete Isabel Kreitz für die Frankfurter Rundschau im Jahr 2009 jede Woche eine Episode zur deutschen Geschichte der Nachkriegszeit. Angefangen bei Thomas Manns erstem Besuch in Deutschland nach 16 Jahren im Exil, wurden die Leser quer durch rund 60 Jahre Geschichte geführt: über den Start des Farbfernsehens, die gefälschten Hitlertagebücher und die Barschel-Affäre bis zur Pleite der Investmentbank Lehman Brothers und die dadurch ausgelöste weltweite Finanzkrise. Diese Arbeiten sind in einem großformatigen Sammelband zusammengefasst bei Dumont erschienen.
Die Doppelseiten sind immer gleich aufgebaut: Am unteren Rand jeder linken Seite ist kurz das jeweilige Ereignis beschrieben, auf der rechten Seite ist dann Kreitz’ Illustration abgebildet. Meist erzählt sie in kurzen Bildergeschichten, die manchmal auch ohne Worte auskommen. Teilweise verwendet sie aber auch Collagen, in die Originaldokumente eingebaut sind. Die an sich bunten, realistisch gehaltenen Zeichnungen sind gleichzeitig auch durch viel Grau geprägt und wirken auf den ersten Blick ziemlich düster. Dieser Eindruck trügt jedoch. Die Geschichten werden nämlich mit hintergründigem, feinsinnigem Humor erzählt, der einen immer wieder schmunzeln lässt.
Bemerkenswert ist, dass die ausgewählten Ereignisse niemals direkt dargestellt werden. Vielmehr werden kleine, alltägliche Geschichten erzählt, in denen das jeweilige Thema lediglich implizit anklingt und die zeigen, wie sich das Leben der Menschen dadurch verändert. Überhaupt werden die ganz großen Momente oft nur am Rande erwähnt. So wird etwa der Mauerfall nur indirekt in einer Episode über einen Besuch Gorbatschows in Berlin thematisiert. Statt auf Plakativität zu setzen, nähert sich Isabel Kreitz diesen prägenden und teils weltbewegenden Geschehnissen auf so subtile wie hintersinnige Weise.
Die Auswahl ihrer Sujets ist dann allerdings doch nicht immer nachzuvollziehen. Man kann sich fragen, warum z. B. so wichtige und einflussreiche deutsche Künstler wie Joseph Beuys oder die Band «Kraftwerk» keine Erwähnung finden, wohl aber Christos verhüllter Reichstag und die Loveparade. Aber dafür lernt man auch viele Dinge – und dies auf eine sowohl äußerst unterhaltsame als auch spannend und anspruchsvoll umgesetzte Art und Weise.
Jan Westenfelder
Isabel Kreitz: «Deutschland. Ein Bilderbuch».
Dumont, 112 S., Hardcover, farbig,
Euro 19.99 / sFr. 28.50
|
|

«Deutschland. Ein Bilderbuch»
|
Walking on the Moon
Der Weltraum steht schon seit einiger Zeit im Mittelpunkt des Schaffens der Wiener Künstlerin Michaela Konrad. So arbeitet sie bereits seit 2003 an ihrer ComicArt-Reihe «Spacelove», die Gemälde, Drucke und Comic-Erzählungen umfasst. Mit ihrem Band «Mondwandler» hat sie sich der besonderen Faszination gewidmet, die der Mond auf uns Menschen ausübt. Als Basis dienten ihr Zitate von Astronauten der amerikanischen Apollo-Missionen, in denen diese ihre Gefühle, Gedanken und Erlebnisse während ihrer Reise zum Mond ausdrücken. Die kurzen Textfragmente wurden in eine Reihenfolge gebracht, an deren Anfang die ersten Empfindungen beim Betreten der Mondoberfläche stehen und deren Ende rückblickende Gedanken nach der Ankunft auf der Erde bilden, so dass sich eine Art lose Handlung ergibt.
Michaela Konrad hat die Texte mit großzügigen, teils ganzseitigen Bildern illustriert. Auf nahezu allen ist die Mondoberfläche dargestellt, auf der sich mal ein Astronaut, eine Landefähre oder ein Mondfahrzeug befinden, die sich aber auch mal völlig verlassen präsentiert. Und dann gibt es da noch eine blonde Frau in einem blauen Kleid, die auf etwa der Hälfte der Bilder zu sehen ist und in den schwarzen Himmel blickt, die Erde betrachtet oder sich die von den Astronauten zurückgelassenen Gegenstände anschaut – eben eine Mondwandlerin. Ist die Mondlandschaft ausschließlich in Schwarz, Grau und Weiß gehalten, steht die mit kräftigen, leuchtenden Farben hervorgehobene Protagonistin in krassem Gegensatz dazu. In Verbindung mit den klaren Linien und dem dicken Strich erinnert dies an Pop Art im Stile Roy Liechtensteins.
Durch das Zusammenspiel der Reflexionen der Astronauten und der surrealen Bilder gelingt es Michaela Konrad, eine traumhafte und sogar etwas meditative und hypnotische Atmosphäre entstehen zu lassen. Man lässt sich nur allzu gerne in diesem ruhigen Fluss treiben, und ab einem gewissen Punkt beginnt man, die Schwerelosigkeit, die Leere und die Stille des Weltalls am eigenen Körper zu spüren. Besonders zu empfehlen: Bei der Lektüre Pink Floyds «The dark Side of the Moon» hören.
Jan Westenfelder
Michaela Konrad: «Mondwandler».
Luftschacht, 64 S., Hardcover, farbig,
Euro 23.30 / sFr. 35.50
|
|

«Mondwandler»
|