| MAGAZIN |
Erinnerungen Ganz schön harter Tobak, den Gipi den Lesern da in seinem autobiografischen Werk „S.“, versteckt hinter bunt leuchtenden Aquarellfarben, zumutet. Gipi setzt in „S.“ Erinnerungen seines Vaters, die vor allem um die Zeit des Zweiten Weltkrieges kreisen, in eine nichtlinear erzählte und immer wieder neu ansetzende Geschichte um, die dem Leser nichts erspart: nicht die Grauen des Krieges, nicht die Brüchigkeit von Erinnerungen und auch nicht die problematischen Seiten dieser Vaterfigur. Der Auftakt zieht den Leser mitten hinein in eine Geschichte, deren Zusammenhänge sich erst nach und nach erschließen lassen. Der Erzähler erinnert sich an einen Schiffsausflug mit seinem Vater, währenddessen dieser von einem Kriegserlebnis berichtet: Gipi zeichnet eine von Luftangriffen zerstörte Brücke, fliehende verletzte Menschen, mit Löchern im Kopf, „so groß wie eine geballte Faust“. Andere Erinnerungen des Vaters: Er hilft zwei jungen deutschen Soldaten zu desertieren, die dann vor seinen Augen von amerikanischen Soldaten erschossen werden; die Alliierten bombardieren Pisa und töten dabei 5'000 Menschen, darunter um ein Haar seine Verlobte, die Mutter des Erzählers, die von einem Deutschen gerettet wird und danach einen „wachsenden Hass auf die Welt“ empfindet; amerikanische Besatzungssoldaten prügeln S. windelweich. Der Leser, der all dies vorgesetzt bekommt, virtuos, mal poetisch und mal derb erzählt und gezeichnet, wird mit der Zeit immer irritierter: Was soll diese permanente Darstellung der Alliierten als mordende Besatzer, als am Boden wie in der Luft willkürlich tötende, feist grinsende Monster, während diejenigen, die für all dieses Leid verantwortlich sind – die deutschen Soldaten nämlich – als Retter inszeniert werden? Etwas verärgert, wird man dennoch immer tiefer in die Geschichte hineingezogen, fängt an zu zweifeln am Erzählten, ebenso wie der Erzähler, welcher seinerseits seine eigenen Zweifel an den Erinnerungen seines Vaters andeutet, wenn er Fragmente dieser Erinnerungen immer wieder neu aufgreift, ein wenig perspektivisch verschoben weitererzählt und so – in die Flüchtigkeit des Aquarellstils eingebettet – eine hochkomplexe Reflexion über Erinnerung, Verdrängung und Vergessen komponiert, um auf das alles ins rechte Licht rückende Finale zuzusteuern: Die Blindheit, die den Vater in den letzten Jahren vor seinem Tod zunehmend befallen hat, wird zur Metapher für die blinden Flecken und Verschiebungen in der Erinnerung, deren „Wahrheit“ sich erst nach seinem Tod entpuppt. So schrieben etwa die deutschen Deserteure noch jahrelang dankbare Briefe an ihre Retter, die sie einst davor bewahrt hatten, von amerikanischen Kugeln zerfetzt zu werden. Aber auch anderes steht plötzlich in Frage: „Die Bombardierung der Brücke und die schwarzen, aufgeblähten Köpfe? Welche Version ist die richtige? Gibt es eine richtige Version?“ Alle Erinnerung ist vermittelt, medial, in Familienerzählungen und auch im Verschwiegenen, sodass dem Erzähler am Ende nur noch bleibt, sich zu befreien von dem Glauben an die Wahrheit und auf sich selbst zurückgeworfen, seinen Vater loszulassen: „Es ist an der Zeit, dass er an die frische Luft kommt, sich im Winde zerstreut, wie er es verdient, dieser Idiot.“ Gipi: „S.“.
|
| Illustrationen von Jürg Lindenberger 
«S.» |
Albträume
Ein „Hair Shirt“ ist ein aus Haaren gewebtes „Büßerhemd“, ein Kleidungsstück, das John – der Protagonist im Comic des Kanadiers Patrick McEown – in wiederkehrenden Albträumen zu tragen gezwungen ist. Der Ich-Erzähler John lebt als Kunststudent in einer nichtssagenden Stadt, über die er sagt: „Diese Stadt existiert nicht. Menschen leben hier nicht, sie zirkulieren nur, wie einsame Satelliten, die um einen Planeten kreisen, den es nie gegeben hat.“ Er treibt nach dem Ende einer langjährigen Beziehung durch das Nachtleben und trifft dort zufällig auf seine Kindheitsfreundin und Jugendliebe Naomi. Ihre Zuneigung lebt wieder auf, gleichzeitig wird schnell deutlich, dass in diesem Wiedertreffen Abgründe der Vergangenheit erneut aufbrechen, Unverarbeitetes zurückkehrt und die Beziehung zunehmend belastet. Naomi hat den frühen Tod ihres Bruders niemals verarbeitet, gleichzeitig wird angedeutet, dass auch andere traumatisierende Dinge in ihrem Elternhaus vorgefallen sein könnten. All dies führt zu einem Verhalten Naomis, mit dem sie sich selbst zu bestrafen scheinen will und gleichzeitig die Beziehung mit John immer wieder vor schwere Prüfungen stellt, bis schließlich alles in einer schicksalhaften Nacht eskaliert. John selber, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt ist, plagen regelmäßige Albträume, in denen gleichfalls Naomis Bruder, mit dem er sich in seiner Jugend zerstritten hatte, auftaucht, ebenso wie eine Freundin Naomis, die John an seine Ex erinnert sowie das titelgebende Büßerhemd, das er zur Strafe sowohl stricken als auch tragen muss. Wofür John Buße tun muss oder glaubt tun zu müssen, was ihn schuldig werden ließ, bleibt nur angedeutet. Ohnehin zeichnet sich „Hair Shirt“ vor allem durch das aus, was im Vagen bleibt, bzw. dadurch, was am seltsamen Verhalten der beiden Protagonisten John und Naomi nicht erklärt wird. Dass alles auch anders sein könnte, wird immer wieder angedeutet. Selbst die etwas zu schnell erzählte „Auflösung“ birgt genügend Offenheit in sich, um den Leser weiterhin verstört zurückzulassen. „Hair Shirt“ versucht, die Verstörung in Bilder zu fassen, die das Erwachsenwerden mit sich bringt, ist jedoch dabei nicht immer ganz schlüssig erzählt. Aber welches Erwachsenwerden ist schon in sich vollkommen schlüssig und ohne Brüche? Patrick McEown: „Hair Shirt“.
|
|
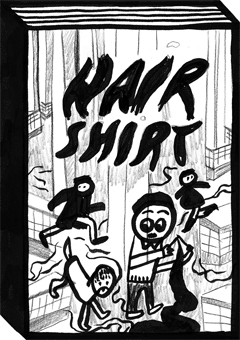 «Hair Shirt» |
Perlen und Muscheln
Fantastische Elemente in eine ansonsten durchaus realistische Welt so nahtlos einzubauen, dass es kaum auffällt, inhaltlich aber Sinn macht, ist nicht einfach. Aisha Franz ist dies bereits in ihrem Debüt „Alien“ trefflich gelungen. Die Metapher des Alien als Spiegel pubertärer Befindlichkeiten ist zwar durchaus ein Klischee, doch gewann ihr die junge deutsche Comic-Autorin dank ihrer charmanten Erzählweise und dem subtilen Umkreisen der Gefühlswelt ihrer Protagonisten viel Neues ab. Aisha Franz: „Brigitte und der Perlenhort“.
|
|
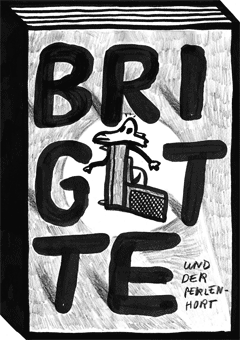
«Brigitte und der Perlenhort» |
Ufos in Lahti
Es beginnt mit Zähneputzen und gegenseitigen Vorwürfen über unsachgemäß aufgerissene Joghurtbecher – und es hört auf mit einem Gehirntumor. Dazwischen taumeln wir mit Fremdling und E-Eisenfrau mehrmals aus dem Alltag in die Hölle und zurück ins Paradies. Marko Turunen: „Der Tod klebt an den Fersen“.
|
|
 «Der Tod klebt an den Fersen» |
Aufschneidereien
Jedes Mal, wenn ein Buch von Henning Wagenbreth erscheint, fragt man sich, warum man seit seinem letzten Buch so lange warten musste und warum er nicht jedes Jahr ein neues Buch vorlegt. Denn wie seine früheren Bücher ist auch „Der Pirat und der Apotheker“ eine beglückende Augenweide. Henning Wagenbreth/Robert Louis Stevenson:
|
|
 «Der Pirat und der Apotheker. Eine lehrreiche Geschichte» |
Spürbare innere Leere
n Indiana. Ihr bester Freund Michael ist vor einiger Zeit nach San Francisco gezogen, ihre Beziehung mit Eric geht den Bach runter. Der Job in einem Klamottenladen in einer Mall ist auch nicht gerade aufregend. Und zu guter Letzt muss sich Amy mit ihrer Mutter herumplagen. Was ihr bleibt, ist vor allem die Animationsserie „Mr. Dangerous“, die zwar höchst surreal ist, für Amy aber das ideale Forschungsobjekt darstellt. Das ist extrem nerdig, und die großen Fragen ihres Lebens beantwortet die Serie auch nicht. Der Einzige, der ihr mit seiner Seelenverwandtschaft helfen könnte bei den vielen Entscheidungen, die man tagtäglich fällen muss, ist Michael. Doch der ist weit weg, und telefonieren ist auf Dauer auch keine Lösung für fehlende Freundschaften. Ein One-Night-Stand mit dem Eismann füllt nur vordergründig die innere Leere, die am nächsten Morgen um so härter in ihr Leben zurückkehrt. Und wieder einmal hat sie alles falsch gemacht ... Paul Hornschemeier: „Mein Leben mit Mr. Dangerous“.
|
|

«Mein Leben mit Mr. Dangerous» |
Echos im leeren Raum
Eine Warnung im Voraus: Ich bin ein ziemlich grosser Fan von Walen. Vom biblischen Jonas über die „Abenteuer des Pinocchio” bis hin zu Herman Melvilles „Moby Dick”, Amerikas ureigentlichem Epos – die Giganten der Tiefe nehmen sowohl in meinem Herzen als auch in der Weltliteratur einen sehr speziellen Platz ein. Daher stürzte ich mich mit grossen Erwartungen auf „The Whale” von Aidan Koch, einer mir noch unbekannten jungen Zeichnerin, die schon einige lobende Kritiken erhalten hat. Das Format von „The Whale” entspricht durchaus nicht dem Thema, es ist eine schlanke Graphic Novel, die weitgehend darauf verzichtet, die titelgebende Kreatur zu zeigen. Der Wal ist eher Metapher (wie literarische Wale das oft sind) für die Zeiten tiefer Traurigkeit, wie sie jeder Mensch im Laufe seines Lebens erleidet. Koch erzählt in einem sehr persönlichen Stil, mittels eleganter Bleistiftzeichnungen und auffallend wenig Text; die ganze Geschichte wird auf etwa 60 Seiten und mit weniger als 200 Buchstaben abgehandelt. Das Ungesagte ist gewichtiger, ist wie ein „Echo im leeren Raum”, um eine der Bildlegenden zu zitieren. Aidan Koch, „The Whale”.
|
|
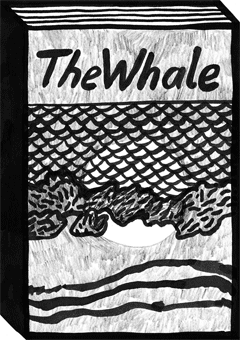
«The Whale» |
Kämpfen, um zu überleben
Das Motto „Kämpfen, um zu überleben“ bekommt beim Lesen von Hertzko Hafts Biografie einen besonders bitteren Beigeschmack. Der bewegenden Lebensgeschichte des jüdischen Boxers, der den Holocaust überlebt hat, widmet Reinhard Kleist nach „Cash“ und „Castro“ seine emotional stärkste Comic-Biografie. Als Vorlage dient dem Berliner Comic-Künstler das Buch „Eines Tages werde ich alles erzählen“, das Hafts Sohn – Alan Scott Haft – über das Lebensdrama seines Vaters verfasst hat. Mit noch nicht einmal 16 Jahren wird Hertzko Haft in ein Konzentrationslager deportiert, weil er seinen älteren Bruder davor bewahrt. Für Haft beginnt eine Odyssee durch die Vernichtungslager der Nationalsozialisten, die er einzig deshalb überlebt, weil er sich im wahrsten Sinne des Wortes „durchschlägt“, nämlich als Boxer bei Schaukämpfen auf Leben und Tod. Während des Nationalsozialismus gab es kaum ein Lager, das nicht Boxkämpfe zur Unterhaltung der Aufseher und Kommandanten veranstaltet hat. Für Haft wird das Boxen zum Überlebensstrohhalm, an den er sich mit aller Kraft klammert. Für seine Gegner, die bei allen Kämpfen gegen ihn verloren haben, 76 an der Zahl, bedeutete dies jedoch den sicheren Tod. Hafts Überlebenswille steht fortan im Konflikt mit seinem Schuldbewusstsein, das ihn noch bis zu seinem Lebensende verfolgen sollte. Die Bilder der Kämpfe wird Haft nie wieder vergessen. Als Harry Haft beginnt er 1948 eine Boxprofikarriere in den USA, doch bei jedem Kampf holt ihn die Vergangenheit ein. Er ist ein gebrochener Mann und unter seinem Trauma leiden seine Frau und sein Erstgeborener, der ihn als „grausamen und gewalttätigen Menschen“ erlebt. Alan Scott Haft wird den Tag nicht vergessen, als sein Vater sagte: „Eines Tages werde ich Dir alles erzählen.“ Vierzig Jahre später tritt Haft zu seinem letzten und wichtigsten Kampf an, und erzählt seinem Sohn seine Lebensgeschichte, der sie für die Nachwelt niederschreibt. Zum ersten Mal kann er verstehen, „wie viel Schlimmes er in seinem Leben mitgemacht hat.“ Reinhard Kleist hat die dramatische Biografie von Hertzko Haft in eine bewegende Geschichte umgesetzt, illustriert in ausdrucksstarken Schwarzweißbildern. Kleist gelingt es, die besonderen erzählerischen Stärken des Comics für seine bildgewaltige Interpretation von Hertzko Hafts Leben kongenial zu nutzen. Bilder einer Lebensgeschichte, die der Leser nicht so schnell vergessen wird. Reinhard Kleist: „Der Boxer. Die wahre Geschichte des Hertzko Haft“.
|
|
 «Der Boxer. Die wahre Geschichte des Hertzko Haft» |
Back to the roots
Kindheitserinnerungen werden durch die unterschiedlichsten Faktoren reaktiviert, ob durch die literarisch viel zitierten Madeleines oder – wie aktuell bei Ulf K. – durch Dolomiti Eis. Menschen des Jahrgangs 1970 werden sich bereits beim Lesen des Titels in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen, an Orte und Begebenheiten wie das Freibad oder die Sommerferien, bei denen das buntzackige Eis am Stiel ständiger Begleiter war. In Ulf K.s aktuellem kleinen, aber sehr feinen Sammelband „Dolimiti Jahre“, der bei seinem Stamm-Comic-Verlag Edition 52 erschienen ist, lädt er den Leser dazu ein, an seinen persönlichen Jugenderinnerungen teilzuhaben, denn er selbst ist 1969 geboren. Die Betonung liegt hierbei jedoch auf „teilhaben“, denn die Episoden sind nicht autobiografisch, sondern nur biografisch gefärbt. Erschienen sind die sieben Geschichten in den Jahren 1994 bis 2012, hauptsächlich für das französische Comic-Magazin Patate Douce. Die Krönung ist sicherlich die Kurzgeschichte „Das Jahr, in dem wir Weltmeister wurden“, die in Zusammenarbeit mit dem Autor Andreas Dierssen entstanden ist und bereits als Einzelheft im selben Verlag erhältlich ist. Aber auch die anderen Episoden aus Ulf K.s „Dolomiti Jahre“ sind mit Bolzplatz und Elba-Urlaubserinnerungen, Ravioli aus der Dose als Leibgericht und mit der ersten heimlichen Liebe, Lenkdrachen und schmerzhaften Impfungen eine wunderbare Reise in die Kindheit – und zwar für frühere als auch spätere Jahrgänge. Allen Geschichten liegt Ulf K.s besondere Gabe zugrunde, die Inhalte sowohl zeichnerisch als auch erzählerisch auf das Wesentliche zu reduzieren, und durch ausgewählte sowie pointierte Elemente erzählerische Momente zu kreieren, in denen der Leser vergisst, dass er einen Comic liest. Viel zu selten erscheinen Comics von Ulf K., arbeitet er doch schwerpunktmäßig als Illustrator. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und vielleicht kommt er ja noch, Ulf K.s großer Schmöker. An der Zeit wäre es!
Ulf K.: „Dolomiti Jahre“.
|
|
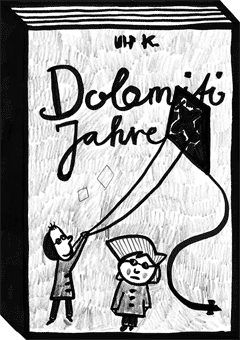 «Dolomiti Jahre» |
Manga goes Gekiga
„Gegen den Strom“ ist ein mächtiger Comic-Klopper, den Yoshihiro Tatsumi, der Vater der Gekiga-Comics 2008 veröffentlicht hat. Nun liegt erstmals die deutsche Version vor, was ein sehr lobenswertes Unterfangen ist, denn dieser japanische Comic entspricht überhaupt nicht dem gängigen Manga-Klischee. „Eine Autobiografie in Bildern“ trägt der Comic als Untertitel, er ist jedoch weitaus mehr. Tatsumi erzählt auf über 800 Seiten nicht nur sein Leben als Comic-Zeichner, von den Anfängen bis hin zu seiner späteren Initiative zur Begründung der Gekiga-Bewegung, wo es darum ging, japanische Comics für Erwachsene zu schaffen. „Gekiga“ wird übersetzt als „Bilderdramen“ oder als „dramatische Bilder“. Tatsumi erzählt ferner von seiner popkulturellen Sozialisierung, von Manga, die er gelesen hat und die ihn inspirierten, oder von der Musik, die damals populär war, sowie von Filmen und deren Schauspielern. Darüber hinaus stellt er den Kapiteln politische Ereignisse voran, wodurch der Leser einen tieferen Einblick in die japanische Kultur erhält. Tatsumi lässt uns ebenso an seiner künstlerischen Entwicklung teilhaben, wie er in den 1950er-Jahren als Jugendlicher erste Comic-Strips für Magazine und Zeitungen entwirft, sich danach an längere Manga-Geschichten wagt und schließlich mit neuen Arten der Bilderzählung zu experimentieren beginnt. Tatsumis künstlerische Laufbahn geht einher mit einer rasant wachsenden Manga-Industrie, in der ein erbitterter Kampf um Zeichner entbrennt, vergleichbar mit der Rangelei um Hochzeitsbilder in den Sonntagsbeilagen der amerikanischen Zeitungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Schließlich wird Tatsumi des Manga-Trubels überdrüssig und gründet mit sechs gleichgesinnten Zeichnern ein Atelier, das sich dem Ziel verschreibt, neue erzählerische Formen zu entwickeln, um sich von den kindlichen und kommerziellen Publikationsvorgaben der großen Manga-Verlage zu befreien. Es ist der Beginn der Gekiga-Comics, in denen vorwiegend realistische Darstellungen zu finden sind und Figuren, die sich durch komplexere Psychogramme auszeichnen. Allein die Tatsache, dass die Zeichner einen individuellen Stil herausgebildet haben, kam einer Revolution gleich. Tatsumi und seine Mitstreiter wurden künstlerische Vorbilder für eine neue Generation von japanischen Comic-Künstlern, deren Werke wir noch viel zu selten im Westen und vor allem auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht sehen. Tatsumi hat mit „Gegen den Strom“ die spannendste und fundierteste Publikation zum Thema Manga- und Gekiga-Kultur veröffentlicht, und auch wenn sich der Begriff „Bildungscomic“ nach pädagogisch wertvoll anhört, so trifft er auf diesen Comic zu. Yoshihiro Tatsumi: „Gegen den Strom. Eine Autobiografie in Bildern“.
|
|
 «Gegen den Strom. Eine Autobiografie in Bildern» |