In Europa ist Shiriagari, geboren 1958, noch kaum bekannt
(was sich durch Angoulême 2006 ändern mag); in Japan hat er
sich als äusserst vielseitiger Zeichner einen Namen gemacht, vor
allem mit der Serie "Yaji Kita in Deep" (1998-2003, 8 Bände
bei Enterbrain). Die Titelhelden, zwei herrenlose Samurai, die auf der
Pazifikseite Japans zum Ise-Schrein wandern und dabei in seltsame Situationen
geraten, entstammen einem berühmten Schelmenroman des frühen
19. Jahrhunderts. Doch viel mehr haben Vorlage und Manga nicht gemein,
denn bei Shiriagari wird der alte Pilgerweg zum gestrichelten Highway
der Träume: Da beten Dorfbewohner einen Holländer mit Superman-Logo
als Götzen an, warten Geister an einer Ampel auf Grün, verlieren
die Hauptfiguren sich immer wieder in den Spiralen einer bodenlosen Welt.
Die Serie, die ab 1997 in dem subkulturellen Monatsmagazin Comic Beam
erstveröffentlicht wurde, bekam zum Erstaunen vieler 2001 von der
renommierten Tageszeitung Asahi Shinbun den Tezuka-Osamu-Kulturpreis verliehen.
Tezukas Witwe hielt damals die Laudatio auf alle Preisträger (Nummer
1 war ihre Schwiegertochter Okano Reiko), aber bei der Nennung des Zweitplatzierten
stockte sie. Dessen Name bedeutet nämlich in etwa "Fortunas
Hinternhoch" (jap. "shiri": Hintern). Eigentlich soll er
nicht pikieren, sondern optimistisch stimmen ("shiriagari" bedeutet
auch: Aufwärtstrend), auf jeden Fall aber andeuten, dass Glückskinder
nur diejenigen sind, die die Dinge lachend zu verkehren verstehen und
zwar in neue Fragen statt alte Antworten.
Der Zeichner, der mit bürgerlichem Namen Mochizuki Toshiki heisst,
studierte an der Tama-Kunsthochschule in Tokio Graphic Design und arbeitete
anschliessend von 1981 bis 1994 in der Werbeabteilung von Kirin Beer.
In seiner Freizeit wurde er Shiriagari Kotobuki. Bereits 1985 erschien
bei Hakusensha mit "Ereki na haru" ("Elektrischer Frühling")
sein erster Sammelband. Dieser fiel zum einen durch witzige Geschichten
um Anzugmenschen und Bürofrauen auf, zum anderen durch Parodien auf
Jugendmanga (u.a. auf Shirato Sanpeis Ninja-Werke). Stilistisch galt er
als "hetauma", denn er zielte auf einen mit technischem wie
intellektuellem Geschick bewirkten Eindruck von Ungeschicktheit (jap.
"heta": unbeholfen; "uma(i)": exzellent). In gewisser
Weise dem europäischen Punk nahe, tauchte diese Kategorie auch im
Musikbereich auf. Beim Manga bezeichnete sie Kritzeleien, die sich gleichermassen
gegen das soziale Sechzigerjahre-Pathos des Gekiga wie gegen die Glätte
der Kulturindustrie sperrten. Dass gerade in der Perfektion des Ökonomismus
der Untergang zu suchen sei, thematisiert Shiriagari noch Jahre später
in "Haikai rojin Don Quichote" ("Stadtstreicher Don Quichote",
2001 bei Asahi Shinbunsha). Ein verwirrter Alter zieht durch Tokio und
kämpft mit seinem Speer gegen Egoismus, Schikanierung und Besitzgier.
Einst ein gefürchteter Firmenboss, attackiert er nun vergebens die
Riesenmonitore in Shibuya Ð ein Bündel heftig gezeichneter Striche
gegen eine mit dem Computer eingearbeitete Fotografie. Aber von Shiriagari
gibt es auch Manga, die auf eine ruhigere Art nachdenklich stimmen. So
handelt "Hinshi no esseiisto" ("Der sterbende Essayist",
Zeitschriftenserie ab 1993) von einem Autor, der auf seiner Suche nach
einem Essay in verschiedenen Episoden dem Sterben begegnet, allerdings
ohne durch vordergründige Tragik den Blick des Lesers zu trüben.
Für die 2002 bei Soft Magic erschienene Buchausgabe liess Shiriagari
die Seiten so bedrucken, als wäre nachlässigerweise etwas verrutscht.
Seither experimentiert er des Öfteren mit dem Buch als Objekt. Dazu
gehört auch die Wiederentdeckung von Pinsel und Tusche, durch die
die Bilder noch stärker handgemacht und auch "japanischer"
wirken, z.B. in den 24 Kapiteln von "Futago no oyaji" (etwa:
"Das doppelte Onkelchen", 1998-2001 serialisiert in Ax, 2002
als Buch im Schuber bei Seirinkogeisha), wo zwei mittelalte, halbkahle
Nackte tief in den Bergen über Zeit und Autonomie, Gott und Demokratie
philosophieren. Shiriagaris Spektrum umfasst darüber hinaus den täglichen
Zeitungsstrip, Comic-Kolumnen in diversen Zeitschriften sowie Installationskunst
in Galerien.
Jaqueline Berndt
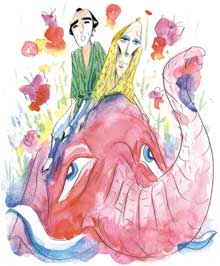
Shiriagari Kotobuki, "Yaji Kita in Deep"