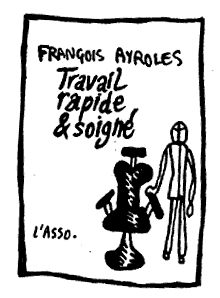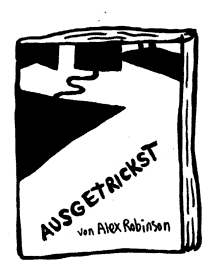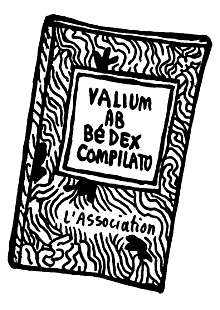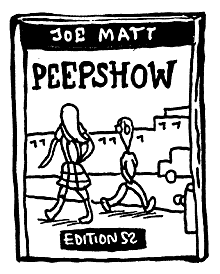Böse Nazis, steife Schniepel
Wie ich von einem Priester missbraucht wurde, wie ich vor den Nazis aufs Land flüchtete, wie ich als Tochter eines Schwulen lesbisch wurde: Betroffenheit und Kitsch haben den Comic erreicht. Die Verlage reissen sich um bekenntnishafte Dramen, das Feuilleton feiert sie ab; Hauptsache, Comics sind «zeitgeschichtlich relevant». Doch die Frage nach der Qualität wird ausgeklammert.
«Warum ich Pater Pierre getötet habe» ist das beste Beispiel für diese Auswüchse im Bereich der Non-Fiction-Comics. Olivier, Sohn einer aufgeschlossenen, antiklerikalen Familie, schliesst Freundschaft mit dem jungen, aufgeschlossenen Priester Pierre – und dieser missbraucht sein Vertrauen während eines christlichen Sommerlagers. Kein Zweifel: Der sexuelle Missbrauch in der Kirche ist ein grosses Thema. Niemand wird bestreiten, dass es traumatisierend ist, den steifen Schniepel eines dicken, vollbärtigen Priesters anfassen zu müssen. Und diese Erfahrungen liessen sich gewiss zu einer wichtigen Geschichte verarbeiten.
Doch Olivier Ka, der betroffene Autor, vergibt diese Chance: kein Tiefgang, kaum Reflexion, keine echte Auseinandersetzung, kein Kontext. Ka stolpert erschreckend unbeteiligt durch seine Vergangenheit (die der Zeichner Alfred unübersehbar in Anlehnung an David B. illustrierte). Seine wieder-holten, eklig larmoyanten Beteuerungen, wie schlimm das alles gewesen sei, verstärken nicht nur den Eindruck erzählerischer Hilflosigkeit, sondern nähren gar den Verdacht, da missbrauche jemand den Missbrauch, um sich zu profilieren.
Dabei begann alles so vielversprechend. Im Sog von Art Spiegelmans «Maus» entdeckte der Comic sein Potenzial, auch ernsthafte, persönliche und zeitgeschichtliche Stoffe umzusetzen. Joe Saccos Reportagen, David B.‘s «Die heilige Krankheit», Marjane Satrapis «Persepolis» oder Craig Thompsons «Blankets» weckten dank ihrer inhaltlichen Relevanz und künstlerischen Qualitäten nicht nur das Interesse des Feuilletons, sondern erschlossen dem Comic auch eine neue Leserschaft. Ihr kommerzieller Erfolg zog aber auch Trittbrettfahrer an. Nun hämmern die Verlage einen Non-Fiction-Comic nach dem anderen heraus; worunter die Qualität leidet und mittelfristig auch der Respekt, den sich die Comics in den letzten Jahren erarbeitet haben. Denn ein gutes Thema allein macht noch keinen David B. oder Art Spiegelman.
Das gilt leider auch für Miriam Katin. In «Allein unter allen» schildert sie, wie sie als kleines jüdisches Mädchen mit ihrer Mutter vor den Nazis aus Budapest aufs Land flüchtet. Sie werden von guten Landleuten aufgenommen und von schlechten ausgenutzt und vertrieben. Sie hungern und frieren, die Mutter wird von einem Nazi-Offizier geschwängert – und nach dem Krieg treffen sie den Vater wieder und wandern gemeinsam in die USA aus. That‘s it.
Von einer Autorin, die sechzig Jahre später mit der Reife und der Erfahrung eines ganzen Lebens auf diese Ereignisse zurückschaut, darf erwartet werden, dass sie ihr persönliches Schicksal zu einer Geschichte von eini-germassen universaler Bedeutung zu verarbeiten vermag und nicht in
der anekdotischen Schilderung eines ungarischen Winters stecken bleibt. «Allein unter allen» mag eine berührende Geschichte geworden sein,
mehr aber auch nicht. Und dies entspricht zweifellos nicht den berechtigten Ansprüchen an diesen Stoff.
Im Gegensatz zu Katin erzählt Alison Bechdel in «Fun Home» eine ver-hältnismässig bescheidene Geschichte: Sie setzt sich mit ihrem Vater und ihrem Coming-Out auseinander. Der Vater war schwul, ohne es je zuzugeben, ausserdem frustriert und verklemmt und deshalb ein Tyrann. Einmal stand er gar wegen Verdachts auf Verführung von Minderjährigen vor Gericht. Kurz nach Alisons Coming-Out wurde er dann von einem Lastwagen überfahren (War es ein Unfall? Selbstmord?). Diesen privaten Stoff umkreist Alison Bechdel, Autorin des hierzulande unterschätzten Lesben-Strips «Dykes To Watch Out For», hartnäckig und mit dem ernst-haften Bemühen, den Vater nachträglich zu verstehen. Sie findet zwar keine abschliessenden
Antworten, schafft aber eine vielschichtige Reflexion über Homosexualität, verlogene Familienidyllen, provinzielle Enge, Literatur als Realitätsersatz und abgewürgte Träume; was weit über das persönliche Drama hinausführt und deshalb auch für Aussenstehende interessant wird.
«Fun Home» ist ein sehr literarischer Comic – zu literarisch vielleicht. Der intellektuell dichte Text reduziert die (zeichnerisch nicht besonders attrak-tiven) Bilder zu Illustrationen, die man nicht selten leicht übersieht. In diesem Sinne hatte das Time Magazin vielleicht nicht ganz Unrecht, «Fun Home» zum besten Buch des Jahres 2006 zu küren – der beste Comic
war «Fun Home» ganz gewiss nicht.
Christian Gasser
|

Olivier Ka (Text), Alfred (Zeichnungen) «Warum ich Pater Pierre getötet habe». Carlsen, 112 Seiten, Hardcover, farbig,
Euro 16.– / sFr. 28.–
Miriam Katin «Allein unter allen». Carlsen, 136 Seiten, Hardcover, schwarzweiss/farbig, Euro 19.90 / ca. sFr. 35.90
Alison Bechdel «Fun Home».
Kiepenheuer & Witsch, 240 Seiten, Hardcover, schwarzweiss,
Euro 19.95 / ca. sFr. 34.90
|