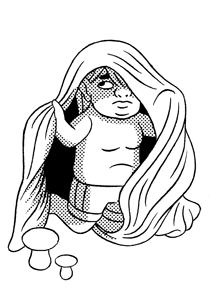Von Frank Schäfer
Illustrationen von Till D. Thomas
Ein Spieleabend. Ich dachte damals, mit dem Ausgang aus der unver-schuldeten Unmündigkeit – mit vierzehn, fünfzehn Jahren oder so –, dass das barmherzige Schicksal mir eine Blanko-Entschuldigung ausge-stellt habe, die mich von solchem Ungemach für immer befreien würde. Aber dann rief mein Freund Thomas an, und der führte ziemlich lose dieses Wort im Munde, das sich mir wie eine Fleischfliegenmade ins eben noch so aufgeräumte Gemüt frass
«Ein Spieleabend! Hast du ‹ne Macke?» schrie ich auf. Sie haben sich gedacht, dass ich so reagieren würde und deshalb schon mal bei meiner Freundin vorgefühlt, die würde kommen und alle anderen auch. Und wenn ich nicht einen Samstagabend allein verbringen wolle oder keine gesteigerte Lust habe, mich schon wieder mit den anderen sozial Benachteiligten im Hinterzimmer der Videothek meines Vertrauens wiederzufinden, dann könne ich es mir ja nochmal überlegen. «Träum weiter», sagte ich, rief meine Freundin an und liess Dampf ab – bis sie auflegte. Ich nahm mir vor, die Beziehung zu beenden, mein Adressbuch um ein paar Seiten auszudünnen, für den Rest der Woche nicht mehr ans Telefon zu gehen und den Samstag mit einem Michaela-Schaffrath-Themenabend zu nobilitieren
.«Hey Frank, schön, dass du mitgekommen bist», begrüsste mich Thomas. Er hielt die Tür auf und ich liess meiner Freundin den Vortritt. Man einigte sich auf «Trivial Pursuit», zwei Teams, Frauen gegen Männer, damit es auch ordentlich rappelte im Karton – was es dann auch tat. Am Ende des Abends musste ich ein Taxi nehmen, weil mich meine Freundin nicht mehr als Beifahrer dulden mochte. Das gastgebende Paar fand sich zu einer Diskussionsrunde zusammen, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte und während der die schon terminierte Hochzeitsfeier noch einmal zur Disposition gestellt wurde. Auch bei den restlichen Spielern gab ein Wort das andere. Nachdem dann etwas Gras über die Sache gewachsen war, wurde beschlossen, auf eine Wieder-holung zu verzichten. Und nach ein paar Monaten konnte man sogar darüber lachen und sich darauf einigen, dass es vor allem eine Szene war, die an jenem Abend die ungute Drift verursacht hatte.
Thomas war dran, zog eine Karte und las der Damenriege folgende Frage vor: Welche Stadt wird auch als «Wiege der Demokratie» bezeichnet? Hilke, damals Studentin der Sozialpädagogik im fünften Semester, heute Leiterin eines Waldorf-Kindergartens, liess sich ihre Freude über den kommenden Triumph sehr wohl anmerken, während wir uns ärgerten. «Scheisse, zu leicht», stöhnte Thomas. Aber wir hatten nicht bedacht, dass Sozialpädagogik keine exakte Wissenschaft ist. «Bremen», rief Hilke erfreut. Die Männermannschaft sah sich ungläubig an, schüttelte leicht verwirrt die Köpfe. Auch Hilkes Kombattantinnen blickten bedenklich, zuckten mit den Schultern und zischten durch die Zähne, als werde hier etwas ganz Heikles verhandelt. Man wusste offenbar nicht so recht. Jetzt wurde auch die angehende Pädagogin un-sicher. «Oder Hamburg», rief sie geistesgegenwärtig. «Eins von beiden. Jedenfalls ‹ne Hansestadt.»
Natürlich habe ich mitgelacht, eimerweise Spott ausgekübelt, die häss-liche Fratze der Missgunst aufgesetzt. Selber Schuld – sozialer Druck hatte mich hierher gebracht und sozialer Druck liess mich nun auch mitspielen. Dennoch, so richtig wohl fühlte ich mich nicht in meiner Haut, denn selbstredend hätte genauso ich es sein können. Oft genug war ich es ja auch.
Schiller, Huizinga und all die anderen hatten nämlich nur teilweise recht – jedenfalls was mich angeht: Im Spiel war ich nie ganz bei mir, jeden-falls nicht im kompetitiven Gesellschaftsspiel, in dem es ums «Schlagen» geht, ums «Rausschmeissen», «Einnehmen», «Wegnehmen», «Kassieren», «Abhängen» und «Direkt-ins-Gefängnis-begeben», ohne Los und 4000 Mark. Nicht weil ich besonders rigide moralische Prinzi-pien gekannt hätte. Auch allfällige ideologische Vorbehalte – dass hier alle doch nur scharf gemacht würden für den sozialdarwinistischen Wettbewerb da draussen und zugerichtet für das kapitalistische System, dessen Gesetze schon den Kleinsten fein antrainiert würden – wären mit meinem gesunden Pragmatismus durchaus auszuhalten gewesen.
Nein, es war viel existenzieller: mir wurde körperlich unwohl. Es war die nackte Angst zu versagen, die mich stets beschlich. Mit allen somatischen Symptomen wie Hand- und Fussschweiss, Nervosität und Kurzatmigkeit.
Die Wettbewerbssituation liegt mir einfach nicht. Denn es stellt sich fast immer ein unangenehmes, dabei höchst merkwürdiges Phänomen
ein – eine Art Ich-Spaltung, die Peter Rühmkorf in seinen Tagebüchern sehr treffend als «Huckauf» bezeichnet hat. Genau das ist es! Eine lästige Marotte, die einen scheinbar ansatzlos überfällt, vergleichbar einem Schluckauf. Man nimmt sich Huckepack, blickt sich selbst über die Schulter, und das maliziöse Hintermann-Ich antizipiert dabei in gewisser Weise schon die Niederlage, belauert einen mit einer Mischung aus Häme und Verdrossenheit. Und weil gewisse Regionen des Grosshirns viel zu sehr damit beschäftigt sind, dieses Alter Ego zu imaginieren, also nicht alle Teile des Verstandes unmittelbar an einem Strang ziehen, ist man tatsächlich intellektuell nicht mehr so leistungsfähig, wie man sein könnte – und verliert. Die klassische «Self-fulfilling Prophecy».
Es gibt eine Ur-Situation, die mit dieser Idosynkrasie etwas zu tun haben könnte. Vielleicht gibt es mehrere, aber diese eine fällt mir immer sofort ein, wenn ich darüber nachsinne, warum ich nie Doppelkopf gelernt
und die Schach AG nur gewählt habe, um als dreizehnter Mann pau-sieren und in Ruhe «Sounds» lesen zu können: Es war ein heimeliger Winterabend in der gut geheizten Stube, die vierköpfige Familie vollzählig versammelt am Tisch, man spielt «Mensch ärgere dich nicht». Es läuft alles recht gut, drei meiner Kegel stehen schon ziemlich nah am heimischen Koben, mit dem nächsten Wurf würde ich den ersten nach Hause bringen. Aber da ist mein grosser Bruder an der Reihe und wirft einen Kegel um, begleitet von den zu erwartenden verbalen Fiesheiten. Dann kommt mein Vater und wirft einen weiteren um. Gelächter erfüllt den Raum. Es war demütigend und ich war den Tränen nah. Schliesslich gibt mir meine Mutter den Rest und befördert auch noch den letzten meiner drei so aussichtsreich stehenden Kegel zurück an den Anfang. Ich verschwand nun schnell, Harndrang vorschützend, aufs Klo und heulte vor Wut und Hass auf meine Familie, die sich gegen mich verschworen hatte. Und es war eine Verschwörung, denn jeder von ihnen hätte genauso gut einen anderen rausschmeissen können! Es hätte bei allen dreien Alternativen gegeben, gerechtere Züge, aber sie hatten es auf mich abgesehen, sie wollten den, der aus der Reihe getanzt war, wieder auf den ihm gebührenden Platz verweisen. Als ich dann, halbwegs wiederhergestellt und verkrampft lächelnd, aber vor Ärger immer noch tremolierend, zurückkam und nun auch noch ihr widerliches Feixen und die spöttischen Andeutungen über mich ergehen lassen musste, was ich denn auf der Toilette so lange gemacht habe und es sei ja auch gar keine Spülung zu hören gewesen, da hätte ich – ich schwöre es! – ohne mit der Wimper zu zucken abgedrückt, wenn mir etwas zur Verfügung gestanden hätte, wo man hätte abdrücken können.
zurück-fühlen in diese emotionale Gemengelage aus Verstörung, Zurückweisung und Enttäuschung, die dann umkippte in erschreckend destruktive Bitterkeit. Ich habe unter anderem deshalb auch Herbert Grönemeyers so leichthin gesungene Botschaft «Kinder an die Macht» immer für kolossalen Schwachsinn gehalten. Und doch weiss ich auch, was Schiller, Huizinga und all die anderen meinten. Denn viel später
traf ich mich fast jeden Abend mit ein paar Freunden in dem ungenutzten Partykeller meines Onkels – dort standen ein paar E-Gitarren, ein
E-Bass, ein grosses schwarzes Drum-Kit, eine alte Orange-Gesangs- anlage. Und in diesem ewigwährenden Sommer in das kühle Verliess hinabzusteigen, speckige Matratzen vor die schmalen Fenster zu
stellen und mit den anderen vier Freunden Riff-Ideen und Fragmente zu kombinieren, umzuformen, zu verwerfen, doch noch einmal zu probieren, aufzustocken, abzurunden und am nächsten Tag weiterzumachen
und am übernächsten auch, und wenn es sein musste, die ganze Woche, solange bis wir da etwas Musikalisches hergestellt hatten, das nichts sollte und wollte, ausser uns fünf zu gefallen – ja, das war wirklich Spielen, wie man es sich idealer nicht denken kann!