NO: 112
111<|>113
FERNSEHSERIEN
150 Comic-Strips von
150 Zeichner und Zeichnerinnen
Peggy Adam, Schweiz
Benjamin Adam, Frankreich
Mari Ahokoivu, Dänemark
Ana Albero, Spanien
Olaf Albers, Deutschland
Hicham Amrami, Frankreich
Anusman, China
Ingrid Aspöck, Österreich
Stefan Atzenhofer
Peter Bäder, Schweiz
Christophe Badoux, Schweiz
Ludmilla Bartscht, Deutschland
Luca Bartulovic, Schweiz
Konrad Beck, Schweiz
Arne Bellstorf, Deutschland
Matthieu Berthod, Schweiz
Larissa Bertonasco, Deutschland
David Boller, Schweiz
Daniel Bosshart, Schweiz
Verena Braun, Deutschland
Andre Breinbauer, Österreich
Ruta Briede, Lettland
Nadia Budde, Deutschland
Neele Bunjes, Deutschland
Frida Bünzli, Schweiz
Burnbjoern, Österreich
Sonia Cartoni, Schweiz
Glen Chapron, Frankreich
Chi Hoi, Hongkong
Karolina Chyzewska
Francesco Ciccolella, Österreich,
Jennifer Daniel, Deutschland
DN, China
Wiglaf Droste, Deutschland
Luke Drozd, GB
Duoxi, China
El Don Guillermo, Frankreich
Exem, Schweiz
Eugen U. Fleckenstein, Schweiz
Aisha Franz, Deutschland
Ganmu, China,
Christian Gasser, Schweiz
Melanie Gerland, Deutschland
Gregor Gilg, Schweiz
Matthias Gnehm, Schweiz
Bärbel Haage, Deutschland
Steffen Haas, Deutschland
Michael Hacker, Österreich
Till Hafenbrak, Deutschland
Stefan Haller, Schweiz
Gunter Hansen, Deutschland
Thomas Hansen, Norwegen
Simon Häussle, Österreich
Gregor Hinz, Deutschland
Sascha Hommer, Deutschland
Line Hoven, Deutschland
Lea Huber, Schweiz
Tom Hubmann, GB,
Jean Jullien, Frankreich
Eszter Kapitany, Ungarn
Helmut Kaplan, Österreich
Magdalena Kaszuba , Deutschland
Jana Klävers, Deutschland
Ivo Kircheis, Deutschland
Rudi Klein, Österreich
Reinhard Kleist , Deutschland
Kathrin Klingner, Deutschland
Rita Kohel, Deutschland
Olav Korth, Deutschland
Isabel Kreitz, Deutschland
Jonathan Kröll, Deutschland
Sabine Kühn, Deutschland
Antonia Kühn, Deutschland
Daniela Kulot, Deutschland
Andreas Kündig, Schweiz
Brendan Leach , USA
Patrick Lenz, Schweiz
Jürg Lindenberger, Schweiz
Ansgar Lorenz, Deutschland
Sébastien Lumineau, Frankreich
Ulli Lust, Deutschland
Matt Madden, USA
Nicolas Mahler, Österreich
Judith Mall, Deutschland
Mamei, Deutschland
Jamil Mani, Schweden
Maotiagao, China
Sandrine Martin, Frankreich
Mawil, Deutschland
JC Menu, Frankreich
Jérôme Meyer-Bisch, Frankreich
Harsho Mohan, Indien
Søren Mosdal, Dänemark
Hannes Neubauer, Deutschland
Nik Neves, Brasilien
Javier Olivares, Spanien
Sarah Paar, Deutschland
Paul Paetzel, Deutschland
Kai Pfeiffer, Deutschland
Christiane Pieper, Deutschland
Prosperi Buri, Frankreich
Léo Quivreux, Frankreich
Rattelschneck, Deutschland
Nadine Redlich, Deutschland
Kati Rickenbach, Schweiz
Leo Riegel, Deutschland
Josephin Ritschel, Deutschland
Nicolas Robel, Schweiz
Thilo Rothacker, Deutschland
Till Runkel, Deutschland
Russlan, Deutschland
Chrissie Salz, Deutschland
David Sandlin, USA
Felix Schaad, Schweiz
Philipp Schaufelberger, Schweiz
Christoph Schuler, Schweiz
Simon Schwartz, Deutschland
Sekharm Shekar, Indien
Mats Sievertsen, Norwegen
Joonas Sildre, Estland
Silvano Speranza, Schweiz
Helmut Steinbach, Deutschland
Jürg Steiner, Schweiz
Story of, China
Edda Strobl, Österreich
Tangyan, China
Maria Tetzlaff, Deutschland
Lira Thales, Brasilien
Till D. Thomas, Deutschland
Pierre Thomé, Schweiz
Tom Tirabosco, Schweiz
Imke Trostbach, Deutschland
Marko Turunen, Finnland
Ulf K., Deutschland
Sara Varon, USA
Rosario Vicidomini
Sibylle Vogel, Österreich
WangXX, China
Pierre Wazem, Schweiz
Thomas Wellmann, Deutschland
Birgit Weyhe, Deutschland
Anja Wicki, Schweiz
Ruedi Widmer, Schweiz
Patrick Wirbeleit, Deutschland
Nicolas Wouters, Belgien
Xiangyata, China
Yancong, China
Inci Yenen, Deutschland
Jennifer Yerkes, Frankreich
Yucco, China
Sarah Zeese, Deutschland
Zhangxun, China
Zuoma, China
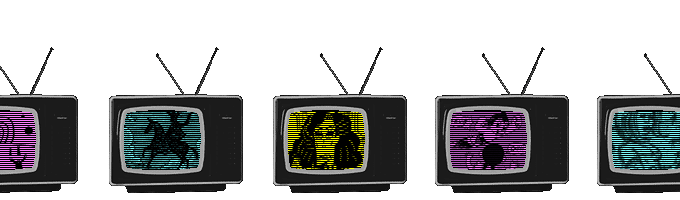
EDITORIAL
STRASSENFEGER
Unser Themaheft «Fersehserien» ist ein Abgesang und romantischer Rückblick auf unsere Jugend, die durch ganz bestimmte, strassenfegende TV-Serien beeinflusst wurde.
Das war die inhaltliche Vorgabe für unsere Zeichnerinnen und Zeichner. Formal mussten sie es in einem Strip, der kürzesten Form eines Comics, ausdrücken, damit möglichst viele Platz in dieser Ausgabe finden konnten. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe!
Auf unseren ersten Aufruf im Februar 2013 meldeten sich über 150 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, von Belgien, über China und Schweden bis in die USA. Da war kein zweiter Aufruf mehr nötig, das Heft war voll! Und als dann alle Ende April ihren Strip einschickten, brach unsere Kommunikation zusammen. Auch die Auswahl der Fernsehserien ist sehr vielfältig: Vom A-Team über Knight Rider, Tokyo Love Story bis Zorro. Einige sind doppelt, wenige dreifach und Twin Peaks vierfach vertreten. Die Reihenfolge ist chronologisch, mit Lassie fängt es 1954 an…
Erfreulicherweise hat sich das Comicfestival Hamburg
(3. – 6. Oktober 2013) entschlossen,
zum Thema dieser Ausgabe mit einer Auswahl der Beiträge eine Ausstellung zu machen.
www.comicfestivalhamburg.de
David Basler und Christoph Abbrederis
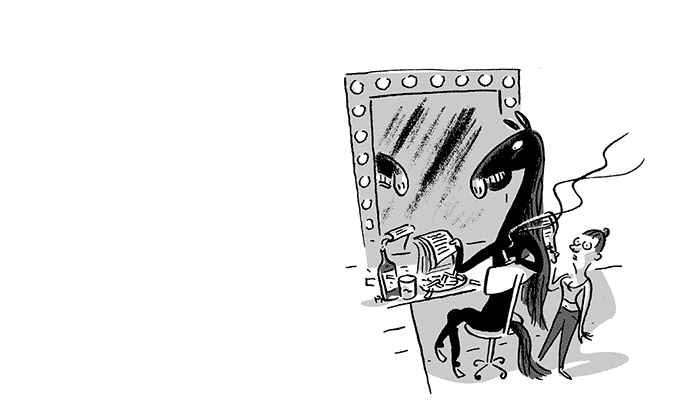
Na Fury, wie wär’s mit einem kleinen Ausritt?
Von Silvano Speranza
Der schnellste und sicherste Weg ein Fernsehjunkie zu werden, sind ab dem Kleinkinderalter täglich verabreichte Dosen hochgradig süchtig machender TV-Serien.
Meine Einstiegsdroge hiess «Fury». Die Geschichte des Waisenjungen Joey, der irgendwo im modernen «Wilden Westen» von einem verständnisvollen und aus unerfindlichen Gründen unverheirateten Rancher auf der «Broken Wheel Ranch» aufgenommen wird. In der Folge gewinnt er das Vertrauen des scheinbar unzähmbaren Rappen Fury (Furie!!).
Die erste Folge von 1955 bezog sich weitgehend auf ein Jugendbuch von Albert G. Miller. Danach folgten bis 1960 weitere 113 Episoden, in denen wechselnde Autoren nach immer gleichen Strickmustern moralinsaure bis humorige amerikanische Wertvermittlungsarbeit leisteten. Das weibliche Geschlecht war in der Regel nur am Rande vertreten. So übernahm der alte, krächzende Pete, des Ranchers Haushälter, gegenüber dem Kind die herbherzliche Mutterrolle.
Mir war egal, dass kaum Frauen vorkamen. Schliesslich fragte ich mich damals auch nicht, weshalb Tick, Trick und Track nur Onkel und Tanten, jedoch keine Eltern hatten.
Viel wichtiger in meinem 10-Jährigen-Universum waren Joey und Fury. Wer von den beiden der grössere Held war, weiss ich nicht. Ich mag zwar fernsehsüchtig geworden sein, aber bestimmt kein Pferdenarr. In diese Art vorerotische Beziehung verstricken sich ja eher Mädchen. Ich selbst bin nur ein einziges Mal, im Schlepptau einer Pferdeflüstererin, auf dem Rücken eines unwirschen Mietgauls gehockt. Kaum hatten wir den nahen Waldrand erreicht, gab dieser mir unmissverständlich zu verstehen, dass er, sollte ich die Zügel nur einen Moment schleifen lassen, unverzüglich in seinen Stall zurückkehren würde. Und das tat er auch – ohne mich. Beim Abstieg von einer steilen Böschung blieb er bocksteif stehen, warf den Kopf samt Zaumzeug mit Wucht nach vorne, um scheinheilig ein paar Blümlein zu beschnuppern, und ich, der ich mich krampfhaft am Lederzeug festgeklammert hatte, saltierte vorwärts in den morastigen Acker.
Joey, der Kinderstar wäre von Fury nie abgeworfen worden. Der grandiose Vorspann zur Serie lässt daran keine Zweifel. Da galoppiert eine grosse Herde «Wildpferde» durch die Prärie – dong – dogodong – dogodong, (dramatische Bläsersätze), dogodong – dogodong, dann ein Knabe, der mit heller Stimme ruft: «Fury, Fury!!». Ein Rappe schert aus und galoppiert nun allein durch zerklüftetes Gebiet, erreicht den Jungen, bäumt sich auf, schnaubt, dass Rotz fliegt. Der Junge schmiegt sich an den Hals des Tieres, gurrt verliebt und sagt den fantastischen Satz: «Na, Fury, wie wär’s mit einem kleinen Ausritt, hast Du Lust?» Das Pferd wiehert ein eindeutiges Ja und geht in bester Zirkusmanier mit der Vorderhand in die Knie, damit Joey aufsteigen und aus dem Bild hinaus direkt ins nächste Abenteuer reiten kann.
Diese Anfangssequenz blieb all die Jahre, in denen die Serie wiederholt wurde, immer gleich. 1988 wurden dann 16 neue Folgen mit neuem Vorspann gedreht. Die habe ich wegen meines vorgerückten Alters an mir vorbeigehen lassen. Aber das konnte ja nicht mehr dasselbe gewesen sein. Das Personal musste völlig erneuert werden. Joey wäre nun ein 45 Jahre alter Waisenjunge gewesen, sein Adoptivvater Jim alias Peter Graves hatte sich längst als weisshaariger Edelagent Jim Phelps in «Kobra übernehmen sie» und «Mission impossible» einen Namen gemacht, und der alte Pete war 1974 gestorben.
Und natürlich musste auch Fury ersetzt werden. Der schwarze Hengst in den ersten Staffeln zwischen 1955 und 1960 hiess eigentlich Highland Dale. Entsprechend der Filme, in denen er erschien, hiess er aber auch Beauty, Black Beauty oder Blacky, und er stand mit Stars wie Elisabeth Taylor und Anthony Quinn vor der Kamera. Dass er das schwarze Pferd des Adam Cartwright in der Serie «Bonanza» gewesen sei, wird gemäss aktueller Fury-Forschung verneint. Offenbar hocken nicht nur menschliche Promis gerne zusammen auf einem Haufen. So soll ganz in der Nähe von Furys Stall auch Lassie gewohnt haben. Fury, der 1972 mit 29 Jahren starb, gehörte zur Rasse der American Saddlebred Horses, einer Züchtung, die sich seit Buffalo Bills Zeiten bestens für den Einsatz im Showbusiness eignet. Er war laut seinem Besitzer Ralph McCutcheon kein «Trickpferd», das einzelne Kunststücke beherrschte, sondern so trainiert, dass er die ständig neuen Anforderungen der Drehbuchschreiber nach einigen Erklärungen und Proben zu begreifen schien. Er konnte tot spielen, lahmen, Knoten und Torriegel öffnen, auf Kommando wiehern, lachen und vieles mehr. Ausserdem verstand er zehn Worte. Doch sein bester Trick war, laut McCutcheon, 5000 Dollar die Woche zu verdienen.
Von den insgesamt 114 Fury-Folgen wurde nur eine einzige nicht auf Deutsch synchronisiert. Sie hiess «Sonic boom» (Überschallknall). Darin ging es um Bomber der amerikanischen Luftwaffe, die zum Ärger der Bewohner Übungseinsätze über der guten alten «Broken Wheel Ranch» flogen. Im Verlauf der mit teurer Technik und Originalaufnahmen der Air Force produzierten Episode liessen sich unsere Helden schliesslich restlos vom Nutzen und der Wichtigkeit der Armee überzeugen.
Auf den flimmernden Bildschirm unseres als Stubenmöbel verkleideten 50er-Jahre- Fernsehers, des Affenkastens, wie mein Vater ihn nannte, hat es der Überschallknall nie geschafft. Das mit dem TV–addict hingegen, das hat Fury einwandfrei hingekriegt.

Die Höhlenkinder
Von Christoph Schuler
Etwa zu dieser Zeit tauchten in unserer Gegend die ersten Fernseher auf. Während unsere Familie die Abende lesend im Bett, am Tisch, in der Badewanne oder im Lehnstuhl verbrachte, die Wohnung ins gelbliche Licht augenfreundlicher Lampen getaucht, blitzte aus dem einen oder anderen Fenster in der Nachbarschaft das Blaulicht des Wohlstandes, untermalt von unverständlichem Gebrabbel, vermischt mit Gongschlägen und Musik, die ebenso plötzlich zum Tusch aufspielte wie sie wieder verstummte. «Teufelszeug», schimpfte Vater, «so was kommt mir nicht in die Wohnung»! Darüber waren wir Kinder nicht erstaunt, hatte er doch bereits den vom Grossvater geerbten Radioapparat aus braunem Bakelit an einen der damals häufig als Hausierer herumziehenden Ölsoldaten verschenkt, weil ihm aufgefallen war, dass ich nachts im schwachen Licht der Wellen-Skala Winnetou I-III verschlang. Es war nicht der Autor, der ihn störte, es war vielmehr die Tatsache, dass ich mich während der Lektüre von Radio Luxemburg mit Popmusik berieseln liess. Der Radio wurde also dem von Industrieöl halbgelähmten Kerl übergeben, was mich zutiefst ärgerte, denn vermutlich war der Mann nicht einmal mehr zum Tanzen fähig. Ein gemeiner Gedanke, aber es machte mich fuchsteufelswild, dass unsere Familie allmählich den Zivilisationsstand von Höhlenbewohnern erreichte. Kein Auto, keine Haushaltmaschinen, kein Radio, kein Fernseher – meine Schulkameraden, von denen längst nicht alle, aber doch bereits zwei oder drei einen Fernsehgerät zu Hause stehen hatten, plauderten in den Pausen mit wichtiger Miene über Fernsehserien, von denen ich keine Ahnung hatte: «Abenteuer unter Wasser», «Fury» oder «Lassie», anscheinend äusserst spannende Filme, die spurlos an mir vorübergingen. Lange wusste ich nicht, wer Mike Nelson war, konnte die Titelmelodie von «Bonanza» nicht pfeifen und einen Collie nicht von einem Dackel unterscheiden.
Doch dann beobachtete ich eines Tages, wie Herr Rossi, ein Vertreter für Hillman-Autos, zusammen mit einem Nachbarn einen voluminösen Karton in die Dachwohnung über uns hievte, in der er mit seiner Frau und vier Kanarienvögeln lebte. Im Karton befand sich, wie mir Herr Rossi stolz verriet, ein Fernseher. Ein Fernseher! Der erste in unserem Haus! Nachdem die Antenne installiert worden war, luden die Rossis alle Hausbewohner zu einer Vorführung ein. Ich weiss nicht mehr, was an jenem Abend im Fernseher lief, vermutlich eine Quiz-Show mit Musik, erfunden von denselben sadistischen Programmgestaltern, deren Nachkommen noch heute im Geschäft sind, aber wie auch immer – von da an war ich vom Fernsehen genauso angefixt wie die Nachbarskinder. Kein Mittwochnachmittag verging, ohne dass einer der Mutigeren bei den Rossis oder den Langs im Nachbarhaus klingelte und fragte, ob wir die gerade aktuelle Fernsehserie schauen dürften, während sich der Rest der Kinderbande im Treppenhaus an die Wand drückte und sich zur Überraschung der Gastgeberin erst dann zeigte, wenn man eingelassen wurde. Frau Lang war es egal, da unter den sechs oder acht oder zehn Kindern, die sekundenschnell in ihre Wohnung drangen und sich auf dem Teppich vor der Glotze (die wir natürlich niemals so abschätzig bezeichnet hätten) niederliessen, immer auch ein oder zwei ihrer Enkelkinder befanden. Der Fernseher stand an der Längsseite des Wohnzimmers auf einem kleinen Tischchen, eine hellbraun furnierte Kiste mit einer eleganten dünnen Messingleiste rund um den kleinen Bildschirm. Das goldfarbene Logo des Herstellers, vermutlich Grundig, prangte zwischen Bildschirm und integriertem Radio; alles in allem war es ein in seiner Modernität beeindruckendes Ding mit vielen Tasten und Knöpfen und einem geheimnisvoll grün leuchtenden Auge. Wir kamen uns vor wie im Cockpit einer Weltraumrakete, nur dass dort keine der runden Häkeldecken lagen, mit denen Frau Lang jede vorhandene Fläche im Raum belegte, also auch den Fernseher. Die ersten paar Male bewirtete sie uns sogar mit Sirup und Biskuits, an denen wir uns die Milchzähne ausbissen; später sass sie jeweils schweigend hinter uns in ihrem Lehnstuhl, häkelte weitere Zierdecken und gab acht, dass wir sofort nach den letzten Fanfaren des Abspanns den Fernseher ausschalteten und ihre stets etwas muffig riechende Wohnung verliessen. Lustiger ging es bei Frau Rossi zu und her. Meist freute sie sich sehr, wenn wir vor ihrer Tür standen, und bat uns herzlich herein, was uns Kinder anfangs etwas irritierte, kamen wir doch direkt von unserem Spielplatz am Flussufer, mit Schuhen, an denen manchmal noch Blut von den Ratten klebte, für deren Schwänze wir im Polizeiposten fünfzig Rappen Belohnung bekamen. Frau Rossi war das egal, so sehr freute sie sich über menschliche Wesen in ihrer Wohnung. Ihr Mann war oft tagelang unterwegs und nur der Fernseher und die Kanarienvögel leisteten ihr Gesellschaft, einmal abgesehen von den paar Flaschen Likör, die bei ihr stets in Griffnähe standen. Die frei in der Wohnung umherflatternden Vögel nervten uns zwar mit ihrem Zwitschern und Fiepen, aber für eine Stunde Fernsehen hätten wir uns auch in einen Käfig voller Pelikane mit Durchfall sperren lassen. Bei Frau Rossi war es dann auch, als ich zum ersten Mal meine Lieblingsserie «Die Höhlenkinder» sah, eine nicht ganz zu Unrecht in Vergessenheit geratene Serie um zwei Kinder, die sich während des Zweiten Weltkriegs in die Berge flüchten und dort in einer Höhle wie die Steinzeitmenschen vom Beerensammeln und der Jagd leben. Heute bin ich überrascht, wie einfach gestrickt die Geschichte ist und wie durchschaubar und billig die Studiokulisse der Höhle wirkt, mit ihren glänzend lackierten Felswänden und dem stets hell erleuchteten Innern, ganz abgesehen vom rauchlos brennenden Feuer und den von den Kindern „erlegten“ Tieren; steifen, ausgestopften Hasen, wie sie in unserer Schule in Glasvitrinen standen. Auch sind die Kinder keine allzu begnadeten Schauspieler und jederzeit erwartet man, am Bildrand die Perche des Tonmeisters oder einen Turnschuh des Kamera-Assistenten auftauchen zu sehen. Aber was kümmerten uns Kinder solche Unzulänglichkeiten – verzaubert sassen wir vor dem Fernseher, fieberten mit den Höhlenkindern mit, wenn Eva sich das Bein brach und Peter wieder einmal kein Reh vor den Pfeilbogen gelaufen war. Dabei war unser Alltag genauso spannend; fast täglich brachen sich Kinder am Klettergerüst auf dem Schulhof Arme und Beine und wer unverletzt davon kam, dem wurden von den anderen mit Steinschleudern und Luftgewehren Löcher in den Kopf geschossen. Aber im Fernsehen hätten wir auch noch die lahmsten und dümmsten Geschichten geschaut, aus dem einfachen Grund, dass sie uns per Fernsehen in die Stube gebracht wurden.
Die letzte Folge der «Höhlenkinder» – ein schnulziges Happy-End – habe ich übrigens erst kürzlich auf YouTube gesehen, denn bald begann Frau Rossi, die Bergamotte-Limonade, die sie uns jeweils vorsetzte, mit Cointreau aufzupeppen, was meiner Mutter weniger gefiel. «Fertig jetzt mit Fernsehen», sagte sie, «lies etwas Gescheites»! Ich verkroch mich in meine Bücherhöhle und machte mich hinter die restlichen dreissig Bände von Karl May.
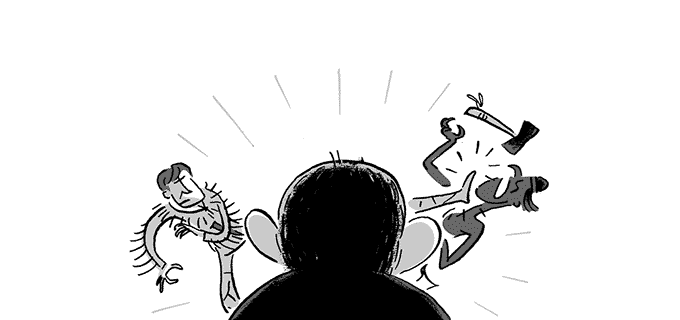
Wir sind freie Menschen
Von Wiglaf Droste
Die Lederstrumpf-Erzählungen
Ich war acht Jahre alt, als ich die «Lederstrumpf-Erzählungen» im Fernsehen sah. Meine Familie – die Grossmutter väterlicherseits, der Vater, die Mutter und wir drei Söhne – sass in Omas Wohnzimmer und starrte gebannt in den Kasten, in dem der weisse Jäger Nat Bumppo und der Indianer Chingachgook zusammen herumstreiften, ritten, jagten, Kanu fuhren, kämpften und einander immer beistanden und aus höchster Not befreiten. Ich war genau im richtigen Stimmungsalter für diese Art von abenteuergesättigter Jungenromantik.
Es war herrlich. Chingachgook, was laut Film «die grosse Schlange» bedeutete, und der Waldläufer Nathaniel Bumppo, der nicht nur «Lederstrumpf» hiess, sondern auch «Wildtöter» oder «Falkenauge», weil er wusste, wie man mit einer Büchse stets unfehlbar ins Ziel traf, waren Blutsbrüder. Das Wort «Büchse» verwunderte mich; in und aus Büchsen kannte ich Thunfisch, Mandarinen, Tomaten oder Bockwürste, aber schnell begriff ich, dass es sich bei dieser Büchse um Nat Bumppos Gewehr handelte.
Die beiden unzertrennlichen Freunde trugen wunderbare Kleidung aus Hirschleder mit Fransen und sahen darin beneidenswert gross-
artig aus; wie sehr wünschte ich, der etwas derart Freiheit Verheissendes noch niemals getragen hatte, mir so einen Anzug beziehungsweise Aufzug zu Weihnachten! Denn es war ja Advent oder sogar schon Weihnachten, als die «Lederstrumpf-Erzählungen» gesendet wurden. (Damals sagte man statt gesendet noch «ausgestrahlt»; diese Formulierung wurde spätestens nach den ersten Protesten gegen Atomkraftwerke dann aber fallen gelassen.)
Es war die Zeit des ZDF-«Weihnachtsvierteilers», viergeteilt wurde allerdings niemand. Im Gegenteil, Vierteiler war ein Versprechen: vier Folgen einer leider viel zu kurzen Serie, deren einzelne Sequenzen mit etwa 90 Minuten Länge aber jeweils Langfilmformat hatten. Dieser Vierteiler trug sein Publikum durch eine der dümmsten und anstrengendsten Zeiten des Jahres, die Weihnachtszeit, in der Zwangsharmonie auf dem Stundenplan stand, auch für Achtjährige.
Aber dann kamen Chingachgook und Lederstrumpf angeritten, rissen ein Gefängnisgitter aus der Wand und damit auch den ganzen Weihnachts-Heuchelhüchel ein; es war aufregend, spannend und schön! Wie Lederstrumpf den Tomahawk, den ein Indianer auf ihn schleuderte, auffing und – wuschsch – direkt zurückwarf, sehr zu Ungunsten der Stirn seines Gegners. Das war keine Haarspalterei, hier ging es um den Schädel und um das darin Eingemachte.
Vier Folgen gab es, vier Wochen der Rettung also, im Fernsehen insgesamt etwa sechs Stunden lang, aber dazu kam ja die noch viel längere Nachspielzeit, die nichts mit der in einem Fussball-Match zu tun hat: Wir spielten das Gesehene bis zur nächsten Folge eine Woche später unendlich oft in allen Varianten nach, mussten aber zu unserem grossen Be-
dauern in Ermangelung eines Beils von der Sache mit dem Tomahawk absehen.
Die Szene ging mir lange im Kopf herum. Ich war bis dahin eher Fernsehnovize gewesen. Fernsehn gab es in meiner Kindheit sehr wenig. Meine Eltern hatten zuerst gar keinen Apparat, dann bekamen sie von meinen Grosseltern, die sich eine neue Flimmerkiste – so wurden Fernseher damals genannt – angeschafft hatten, einen düsteren Kasten geschenkt, der mit Ach und Krach gerade das Erste Programm schaffte, und das auch nur sehr grieselig. Auf dem Bildschirm sah es aus wie Graupelschauer, und für meine beiden Brüder und mich gab es das «Sandmännchen» als Schneegestöber. Nur Sport durfte, wenn auch in nämlicher Qualität, immer geguckt werden; mein Vater war Gymnasiallehrer für Englisch und Sport und begeistert leichtathletisch, sehr gern auch beim Zuhauen.
Erst nach dem Umzug in das umgebaute Haus meiner Grossmutter – mein Grossvater, von dem ich nur noch weiss, dass er nach Haaröl roch und sich scheitelte wie ein Sardellentiger, war unterdessen von mir unbemerkt verstorben – ergaben sich mehr Fernsehmöglichkeiten. Oft musste das heimlich geschehen; wir schlichen dann in den Küchenflur meiner Oma, von dem aus man freien Blick auf den Fernseher hatte und sehen und hören konnte, was die im Wohnzimmer hockenden Erwachsenen glotzten. Heikel wurde es, wenn einer von ihnen aufstand, dann galt es, blitzschnell und lautlos zu verschwinden. Es gelang erstaunlich oft.
Manchmal durften wir aber auch ganz offen mit auf dem Sofa sitzen; zum Beispiel eben beim Weihnachtsvierteiler. Mein erster davon war «Tom Sawyer und Huckleberry Finn» im Jahr zuvor gewesen, und ich erinnere mich heute noch an die klappernd kalte Angst, die ich vor «Indianer-Joe» hatte. Aber es handelte sich um Verfilmungen von Weltliteratur, und so war das Fernsehgucken gestattet, eben auch der «Lederstrumpf», der war ja von James Fenimore Cooper, also irgendwie «wertvoll».
Zwar musste man sich hinterher noch den Gratissermon anhören, um wie viel besser doch die literarische Vorlage sei und das Fernsehen doch so banal, beinahe so schlimm wie Comics.Aber diese ressentimentgeladenen Vatermorgana-Monologe kannte man ja schon vom Mittagstisch. (Als ich später Romane von Cooper geschenkt bekam, empfand ich sie als öde, zäh und weitschweifig; lediglich zum Einschlafen waren sie gut geeignet.)
Erst viel später begriff ich, warum ausgerechnet Lehrer, diese perfekt unerträglichen Konfektmischungen aus halber Bildung und ganzer Beschränktheit, immerzu von «Werten» sprechen. Und warum viele von ihnen, seitdem es sie gibt, die «Grünen» wählen. Genau deshalb. Wer schon immer alles weiss, muss ja nicht mehr hinsehen.
Ich sah und hörte genau hin, und als in der dritten «Lederstrumpf»-Folge, «Das Fort am Biberfluss», Nat Bumppo zu Chingachgook sagte: «Wir sind freie Menschen», dachte ich glücklich: Ja, und so wird es sein.
Später wurde mir klar: Man muss deshalb, zum Glück für sich selbst und alle anderen, kein Lederfransenhemd anziehen.
P.S.:
Etwa 40 Jahre später lief ich beim Weihnachtseinkauf durch die DVD-Abteilung einer Buchhandlung. Für Freunde hatte ich schon alles gefunden, als mir plötzlich die «Lederstrumpf-Erzählungen» ins Auge sprangen. Das war mein Weihnachtsgeschenk an mich! Noch am selben Abend sah ich mir alle vier Folgen an und stellte fest: So viel Sorgfalt waltet in Fernsehproduktionen selten. Hellmut Lange als Nat Bumppo und Pierre Massimi als Chingachgook machen ihre Sache ausgezeichnet. Und als ich den Satz «Wir sind freie Menschen» hörte, fiel mir alles wieder ein, ich weinte und lachte vor Trauer und Glück und wusste genau, warum.
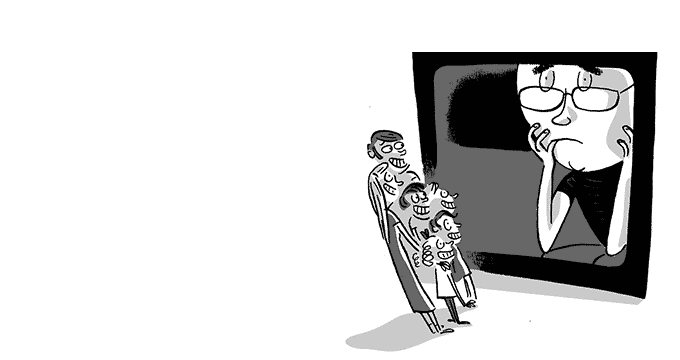
Drei Mädchen, drei Jungen und ich
Von Christian Gasser
Im Mai 1995 wurde ich an mein erstes amerikanisches Barbecue eingeladen. Es fand an einem verregneten Sonntag im Wochenendhaus des Freundes eines Bekannten statt, etwa zwei Stunden von Manhattan entfernt im düster bewaldeten Hinterland von New Jersey. Während die Jungs sich kunstvolle Hamburger bauten, debattierten sie über Baseball, und ich hörte mit höflichem Desinteresse zu. Dann verschob sich das Gespräch zum anderen an gesellschaftlichen Anlässen unumgänglichen Thema: Fernsehserien. Ausgehend von der Frage, ob Al Bundys Frau sexy («a babe») sei oder nicht, landeten sie bei einer anderen schrecklich netten Fernsehfamilie – «The Brady Bunch». Das höfliche Desinteresse des fernsehlos Aufgewachsenen wich erhöhter Aufmerksamkeit, als ihre Erinnerungen sich auch in mir zu einem konkreten Bild zusammenfügten. Ob sie, unterbrach ich sie nach ein paar Minuten, über die Serie mit den drei Mädchen und den drei Jungen redeten? Sie nickten, und ich strahlte, weil ich mich nicht länger wie ein Aussenseiter fühlte: «Bei uns», erklärte ich, «hiess sie ‚Drei Mädchen und drei Jungen‘, und ich liebte sie.» – «Oh», sagte einer, «cool» ein anderer, und die übrigen starrten mich erwartungsvoll an.
Patchwork avant la lettre
«Drei Mädchen und drei Jungen» lief in den frühen Siebzigerjahren am späten Freitag Nachmittag zwischen «Väter der Klamotte» (die von Hanns-Dieter Hüsch auf unerträgliche Weise nachsynchronisierten stummen Kurzfilmkomödien aus der Frühzeit des Kinos) und dem Abendessen.
Die Ausgangslage ist simpel und komplex zugleich: Ein Witwer mit drei Söhnen zieht mit der alleinstehenden Mutter von drei blonden Töchtern zusammen. Womöglich war auch die Frau verwitwet, vielleicht aber geschieden, so genau wurde das nie erklärt, und Letzteres wäre in der damaligen Fernsehwelt einem schlimmen Tabubruch gleichgekommen. Diese Patchwork-Familie «avant la lettre» lebt in einem typischen Haus in einem typischen Vorort ein typisch amerikanisches oder besser: ein gnadenlos normales Leben.
Es war mein erster Einblick in den American Way of Life, grenzenlos naiv und vermutlich als Gegenentwurf zum gesellschaftlichen Aufbruch der Sechzigerjahre inszeniert. Alles ist schrecklich nett und sauber, sogar die Pubertät ist harmlos, an echte Konflikte erinnere ich mich nicht – und offenbar gefiel diese Idylle nicht nur den typisch weissen Amerikanern, sondern auch mir.
TV-DNS
Unter den neugierigen Blicken suchte ich meine Erinnerungen nach irgendetwas ab, das ich hätte sagen können. Vergeblich. Ich erinnerte mich nicht einmal an die Namen der Kinder, ich hätte nicht sagen können, mit welchem Jungen ich mich identifizierte oder ob ich für eines der Mädchen schwärmte. Mir kam nur die Episode in den Sinn, in der einer der Buben eine Schularbeit über die amerikanischen Pioniere schreiben musste. Weil sich die Bradys kurz zuvor eine Super-8-Kamera angeschafft hatten, drehte er im Garten einen Film über das Leben seiner Vorfahren. Auch von diesem Film ist mir wenig mehr als ein Bild geblieben: Wie die Familie in Zeitlupe (die Kamera war falsch eingestellt) durch den Garten tanzt, während jemand aus dem ersten Stockwerk eine löchrige Daunendecke ausschüttelt, deren Federn Schneegestöber suggerieren sollen.
Das war alles andere als ein souveränes Debüt in der Smalltalk-Hölle des typisch amerikanischen Barbecues. Umso beeindruckter war ich, wie kenntnisreich meine typisch amerikanischen Fernsehfreunde sich übertrumpften mit akkurat geschilderten Lieblingsszenen, und wie selbstverständlich sie die Entwicklung der Charaktere von Staffel zu Staffel reflektierten und wussten bei welcher Szene Greg (der älteste Sohn) angeblich bekifft zum Dreh erschienen war … Diese Amerikaner, sagte ich mir staunend, haben die Fernsehprogramme ihrer Kindheit tatsächlich in ihrer DNS eingeschrieben.
Die Telenovela in der Kneipe
Das ist bei mir anders. Ich bin, wie gesagt, ohne Fernsehen aufgewachsen. Meine Eltern untersagten meiner Schwester und mir den Fernsehkonsum zwar nicht, aber wir hatten keinen Fernseher zuhause. Mich störte das nicht, obschon das Fernsehen damals tatsächlich wichtig war: Es gab nur eine Handvoll Sender und ihre überblickbaren Programme gaben die Themen für Schulhofgespräche und Rollenspiele vor. Da aber so gut wie alle meine Freunde einen Fernseher hatten, schaffte ich es problemlos, mehr oder weniger auf dem Laufenden zu bleiben, die Kinderstunde (mit «Dominik Dachs») nicht zu verpassen und dann und wann «Die Sesamstrasse», «Pan Tau» und (mit einer Mischung aus Faszination und Verwirrung) «Raumschiff Enterprise» zu schauen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich das Fernsehen bis heute als ein kollektives Medium betrachte und mich gerne in Ländern aufhalte, in denen man sich am Vorabend zum Telenovela-Schauen in der Quartierkneipe einfindet.
Meine Schwester und ich hatten uns dermassen an die Vorteile der Mattscheibenfreiheit und des Glotzen-Squattings gewöhnt, dass wir uns mit Händen und Füssen wehrten, als unsere Eltern in den späten Siebzigerjahren einen Guckkasten anschaffen wollten. Sehr zu ihrer Verblüffung – sie hatten diese Anschaffung in erster Linie unseretwegen in Betracht gezogen, aus Angst, wir könnten zu populärkulturellen Aussenseitern werden …
Vermutlich kam diese Sorge zu spät. Zu diesem Zeitpunkt war ich längst ein Bücher und Kinofilme verschlingender Postpunkschnösel, der zu einer prinzipiellen Ablehnung der Propagandamaschine Flimmerkiste gefunden hatte. Es war auch die Zeit von «Dallas», und die Folge, die ich bei Robin sah, fand ich dermassen öde, dass ich nach zehn Minuten auf eine weitere Partie «Pong» drängte, die ich mangels Trainings wie immer verlor.
Ausserdem hatte ich unterdessen begriffen, wie Fernsehserien funktionieren: jedes Mal neu, aber in Wahrheit jedes Mal dasselbe. Eine halbe Folge von «Dallas» reicht aus, um zu verstehen, was gespielt wird. Die drei oder vier «Raumschiff Enterprise»-Folgen genügten, um das Prinzip der Serie zu verstehen. Hat man das Prinzip verstanden, benötigt man keine weiteren Folgen, um auch mit Fans und Experten auf Augenhöhe zu debattieren oder auf dem Schulhof Captain Kirk oder Pan Tau zu spielen. Statt Zeit vor der Röhre zu verschwenden, ging ich lieber nach draussen oder vergrub mich in einem Buch, einem Comic oder einer Schallplatte.
Keine Nostalgie
Vermutlich erzählte auch jede Folge von «Drei Mädchen und drei Jungen» dasselbe. Und doch plante ich die schulfreien Freitag Nachmittage so, dass sie jeweils vor einem Bildschirm, wenn möglich einem farbigen, endeten – ob bei Robin, Toni, Elisabeth, Fabio, Jürgli oder auch bei Grabers war letztlich egal. Und doch ist nichts hängen geblieben. Selbst als ich unlängst auf YouTube in ein paar Folgen reinschaute, lösten sie in mir nichts aus. Kaum Erinnerungen, keine Nostalgie, keine Emotionen. Im Gegensatz zu «Dominik Dachs», «Raumschiff Enterprise» oder «Bugs Bunny» hinterliess meine Lieblingsserie in mir keine Spuren. Oder höchstens sehr indirekt: An jenem Barbecue wurde mir klar, dass mir die dysfunktionale Familie Bradley des Comic-Zeichners Peter Bagge dermassen gut gefiel, weil seine satirische Vision des Vororts als Vorhölle die Antwort war auf die in «The Brady Bunch» zelebrierte heile Welt.
Meine Bewunderung für meine typisch amerikanischen, vermutlich in eben dieser Vorhölle aufgewachsenen Fernsehfreunde erhielt einen Dämpfer, als ich realisierte, dass sich ihr Wissen über «The Brady Bunch» nicht allein aus Erinnerungen an ihren kindlichen Fernsehkonsum nährte, sondern aus seiner Auffrischung durch die pausenlosen Wiederholungen auf den unzähligen amerikanischen TV-Sendern. Einerseits beruhigte mich das. Andererseits fand ich das aber auch beunruhigend: Ist es nicht noch beängstigender, dass sich Erwachsene freiwillig selbst die belanglosesten Serien ihrer Kindheit wieder reinziehen? Den Kult um «Raumschiff Enterprise» kann ich nachvollziehen. Aber «Drei Mädchen und drei Jungen»?
Beinahe hätte ich es geschafft, «Drei Mädchen und drei Jungen» ganz zu vergessen, doch just das richtige Leben erinnerte mich an meine Lieblingsfamilie: Als nämlich eine gute Freundin, die alleinerziehende Mutter von drei Kindern (eine Tochter, zwei Söhne) sich in einen alten Schulkameraden verliebte, auch er geschieden mit drei Kindern. Ein aktuelles Remake von «Drei Mädchen und drei Jungen», mit den heutigen Mitteln und Möglichkeiten des Fernsehens erzählt, könnte sehr interessant sein. Aber da jede Zeit die Fernsehserien verdient, die ihr vorgesetzt werden, wuchs ich halt mit dem Original von «Drei Mädchen und drei Jungen» auf. Gebracht hat‘s mir nichts, geschadet vermutlich auch nicht.
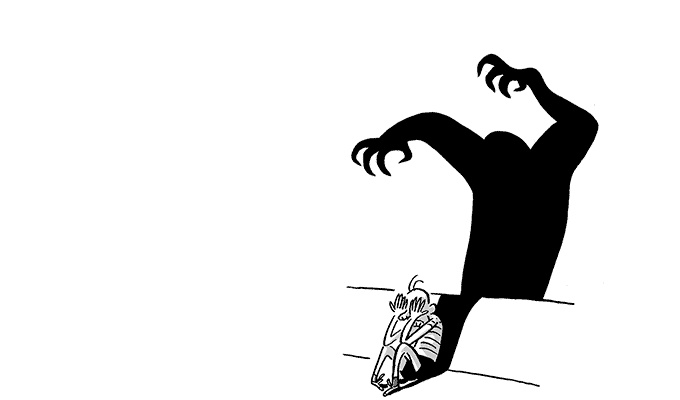
DAS GESCHRIEBENE WORT
von Wolfgang Bortlick
Mit Schirm, Koks und Mao – Serien und Literatur
Wie selig war die Zeit der Knabenspiele
Als Kummer noch nicht nächtlich mich umschlang
Und harmlos ich mit glücklichem Gefühle
Für Gegenwart durch Thal und Wiesen sprang
Und flink und froh ich zum gewählten Ziele
Nämlich zu meiner Oma hinhetzte, diese Zeilen von Novalis nachlebend. Denn die Mutter meiner Mutter nannte schon in den späten 1950er-Jahren einen Fernsehapparat ihr eigen. Das Fenster zur Welt stand da in dunkelbraunes Furnierholz verpackt in der guten Stube und flimmerte aus einem sehr kleinformatigen Bildschirm in körnigem Schwarzweiss.
Aber es war das Fenster zur Welt und ich schaute aus meinem kleinen Dorf hinaus, beispielsweise auf die Olympischen Sommerspiele 1960 in Rom. Der Amerikaner Donald Bragg gewann die Goldmedaille im Stabhochsprung, das ist meine allererste Erinnerung ans Fernsehen. Und danach kam dann auch schon eine TV-Serie aus jener Zeit.
«Coming of Age» heisst nicht nur eine ziemlich überlustige TV-Serie der BBC, heute nennt man eine ganze Literaturgattung so. Romane mit Jugenderinnerungen. Erste Liebe, erster Sex und erster Kummer. Schulung des eigenen Selbstverständnisses und des Verhältnisses zur Welt. Der Eintritt in die furchtbaren Sphären der Erwachsenen undsoweiter. Holden Caulfield lässt grüssen. Der Schriftsteller Jochen Schimmang, geboren 1948, veröffentlichte 1979 seinen ersten Roman mit dem Titel «Der schöne Vogel Phönix». Es handelt sich dabei um eine sehr autobiographische Entwicklungsgeschichte eines jungen Menschen aus Norddeutschland: vom Ableisten des Militärdiensts in der Provinz über Berliner Studentenjahre im Banne des Marxismus-Leninismus sowie der Befreiung von derlei Sinnesverwirrung bis hin zu einer ungewissen Zukunft als ebenso diplomierter wie arbeitsloser Politologe. Sehr schön erhellt das Buch die dunklen und bleiernen Jahre der linken maoistischen Parteibildung im Gefolge der Studentenrevolte von 1968, wo eigentlich intelligente Menschen plötzlich an einer Überdosis Lenin, Stalin und Mao zu Grunde gingen. Schimmang nennt es das «Berliner Gift», aber das gab es damals ja überall, auch hier in der schönen Schweiz. Dass dann später die Wiedergewinnung des Individuums nur mit einem schlechten Gewissen erarbeitet wurde, merkt man den heutigen Grünen und Linken immer noch an.
Auch als alter Mann habe ich beim Betrachten des bewegten Bildes noch dasselbe Problem, welches ich schon als Halbwüchsiger hatte, dass ich nämlich nicht hinschauen kann, wenn es in einer TV-Serie wirklich aufregend, dramatisch, heimtückisch, gefährlich oder tödlich wird. Wenn also in den 1960er-Jahren Fury, der schwarze Pferdeteufel mit dem guten Herzen, hochstieg und wild wieherte, dann sauste ich prophylaktisch auf die Toilette. Denn dann wurde es dramatisch. Oder wenn die Strohballen vor dem Zirkus, in dem Corky, der Zirkusjunge, arbeitete, Feuer fingen, ohne dass es einer merkte und höchste Gefahr für das gesamte lebendige Inventar des Zirkus bestand – dann war ich sofort weg vom Bildschirm. Dermassen liess man sich von einer Pseudo-Realität verführen. Der jugendliche Hauptdarsteller des «Circus Boy» war übrigens Mickey Dolenz, der später dann noch als Drummer und Sänger der Pop-Band The Monkees Karriere machte.
Pferde, tote und lebendige, kommen zuhauf im neuesten Krimi von Dominique Manotti vor. Die armen Viecher werden ebenso brutal wie raffiniert zum Kokainschmuggel benutzt. Der Roman spielt im Jahr 1989, in dem nicht nur der reale Sozialismus abserbelt, sondern im Frankreich der Mitterrand-Ära auch die politische Linke in die Macht eingebunden wird und die Korruption auf allen Seiten floriert. Neben den toten Pferden gibt es auch tote oder vielmehr ermordete Menschen und der homosexuelle Kommissar Daquin vom Drogendezernat stochert dabei mit seiner ziemlich fähigen Polizistencrew in diversen Wespennestern herum. Denn die letztendlich Verantwortlichen für Mord, Drogenschmuggel und Grundstücksspekulation sitzen an höchster Stelle. Dominique Manotti, die Grande Dame des Politkrimis, zeigt auf heiterste und spannendste Weise auch in diesem Roman, der schon vor über 15 Jahren im Original erschien, wie die Dinge in der Gesellschaft laufen.
Grade jetzt will mir meine Jüngste die HBO-Serie «Game of Thrones» (nach der Fantasy-Roman-Serie von George R. R. Martin) näher bringen, aber ich bin einfach nicht für dieses blutige Spektakel gefertigt, auch wenn es eigentlich um Moral und soziale Verantwortung geht. Schon nach zwei Minuten muss ich dringend aufs Klo. Wie die heutige Jugend derlei Brutalität auf dem Bildschirm überhaupt aushält? Und nicht nur das.
Mir fällt auch auf, dass es immer mehr Sitcom-Serien gibt, in denen sprachlich eine explizit freizügige Sexualität vorherrscht. Der Rammelwunsch erscheint als der einzige Gehalt von sämtlichen Erzählungen und Bildern dieser Serien. Vordergründig geht es zwar möglicherweise um die sozialen Nöte von theoretischen Physikern, aber eigentlich wollen die Nerds aus «Big Bang Theory» – wie schon der Titel als Anspielung evoziert – nur das Eine!
Der Protagonist des Romans «Gleichung mit einer Unbekannten», der 2002, zwei Jahre vor der Gründung von Facebook spielt, ist auch ein Nerd. Eric Muller ist an der High School der komplette Aussenseiter und Loser, nicht nur, weil er ein Muttersöhnchen ist und Superhelden-Comics liest, sondern auch, weil er immer alles ganz richtig machen will. Eigentlich ist er aber ein Computergenie und verdient noch sehr jung ein Vermögen mit einem Web-Dienst. Doch die Frauen sind ihm nach wie vor das grosse Rätsel. Als er sich in die als kritische Journalistin arbeitende Maya verliebt, will Eric wieder alles richtig machen und nach Plan vorgehen. So versaubeutelt er diese Beziehung gründlich. Das mag jetzt alles ein bisschen klischeehaft klingen, aber der Autor dieses Romans, der 40-jährige Gabriel Roth, Schriftsteller und Software-Entwickler, erzählt das Wehen und Wollen seines Helden sehr abgespeckt und flüssig. Ausserdem gibt er einen schönen Einblick in die IT-Welt.
Nochmal zum gesprochenen Sex in den Serien: Wenn früher Lassie wild bellend das Herrchen aus dem Moorloch retten wollte, dann war da keine sexuelle Konnotation. Und der dicke Hoss von der Ponderosa war trotz aller Raubeinigkeit ein formvollendeter Gentleman im Umgang mit Damen.
Heute erschöpft sich der narrative Strang einer TV-Serie leider oft in allerhand feuchten Sprüchen, und in den neueren Serien sind es noch öfter junge Damen, die sich darüber unterhalten, wen sie wieder flachgelegt haben. Früher war das anders, in «Dallas» oder «Denver Clan» wurde der Counterpart nach gelegentlichem Sex vor allem ökonomisch flachgelegt bzw. ruiniert.
Die Erotomanie dieser neuen Serien erschöpft sich bald in Langeweile und als Gegenschnitt höre ich mir lieber den «Polizischt Wäckerli» an, die erfolgreiche Hörspielserie von Radio Beromünster aus den Jahren 1949 und 1950. Die Stringenz der Handlung, der saubere Plot, die kunstvolle Schlankheit der Dialoge, die Klarheit der Aussage ohne modisch aufgesetztes Problembewusstsein, die immanente Ethik, das begeistert, da kann kein Schweizer «Tatort» oder ähnliche Versuche mithalten.
Einer der besten Krimis der letzten Zeit kommt aus Brasilien, dem vor kurzem noch krisengeschüttelten Staat. Die Handlung ist geradezu barock. Ein Privatflugzeug stürzt im Norden Brasiliens ab. An Bord befinden sich der Sohn reicher Viehzüchter und ein Kilo Kokain. Der recht zweifelhafte Romanheld, ein erfolgloser Geschäftsmann, der aus Sao Paulo geflüchtet ist, findet den tödlich Verletzten und schnappt sich das Rauschgift. Als er damit handelt, beginnt sein unaufhaltsamer Abstieg ins Verbrechen. Doch seine Freundin Sulamita, die ausgerechnet bei der Polizei und im Leichenschauhaus arbeitet, hilft ihm aus der Bredouille. Die beiden schmieden einen schwindelerregenden Plan mit einer Leiche, um ungeschoren davon und zu Geld zu kommen. Schliesslich ist man in Brasilien, wo Erpressung, Korruption sowie Bestechung alle Ebenen der Gesellschaft beherrschen. Patricia Melo, 1962 in Sao Paulo geboren und jetzt in der Schweiz lebend, hat einen atemberaubenden Thriller mit einem überraschenden Ende geschrieben. Auch sprachlich ist dieser Roman durch die stakkatohaften inneren Monologe des äusserst ambivalenten Helden ein ausserordentliches Werk.
Bücherliste
- Jochen Schimmang: «Der schöne Vogel Phönix»
- Nautilus, 350 S., Softcover, Euro 18 / sFr. 27.90
- Dominique Manotti: «Zügellos»
- Ariadne, 286 S., Softcover, Euro 18 / sFr. 25.-
- Gabriel Roth: «Gleichung mit einer Unbekannten»
- Diogenes Verlag, 324 S., Softcover, Euro 14.90 / sFr. 19.90
- Patricia Melo: «Leichendieb»
- Tropen, 202 S., Hardcover, Euro 18.95 / sFr. 26.90

DAS MAGAZIN
Tamburini/Liberatore/Chabat: Ranxerox. Edizione Integrale

Kopiermaschinen-Mann
Die studentische Protestbewegung Italiens von 1977 («Movimento del ’77»), der Terror der «Bleiernen Zeit», der Post-Punk: Dies sind einige der Zutaten, die den italienischen Underground-Comic entstehen liessen. Eine Metapher für diese Periode ist Stefano Tamburinis (1955-1986) Android Rank Xerox. Die in einer Zeitspanne von fast 20 Jahren erschienenen Geschichten wurden kürzlich in Italien zum ersten Mal in einer Gesamtausgabe veröffentlicht. Auf den Seiten der Avantgarde-Zeitschrift Cannibale (1977-1979) textete und zeichnete Tamburini mit der Unterstützung von Andrea Pazienza und Tanino Liberatore die ersten Geschichten des «synthetischen Proletariers». Dieser wurde von einer Studentenbewegung aus Bauteilen einer Kopiermaschine (der Marke Rank Xerox) zusammengebaut. Durch einen Programmierfehler tendiert Rank zu extremer Gewalt und Drogen- und Sex-Konsum, ebenso ist er der zwölfjährigen Lubna verfallen. Die Liebe des Androiden zum Mädchen zieht sich als roter Faden durch die Abenteuer in einem dystopischen Rom der (damals) nahen Zukunft. Die drogenabhängige Lubna nützt die Gefühle der Maschine schamlos aus und lässt den Kopiermaschinenmann über Leichen gehen, damit ihre Wünsche befriedigt oder ihr aus der Klemme geholfen werden kann.
Nach den anfänglich dem Underground verpflichteten kruden Schwarzweiss-Zeichnungen von Tamburini übernahm in den 1980er-Jahren in der Zeitschrift Frigidaire Tanino Liberatore die alleinige Verantwortung für die Illustrationen, während Tamburini bis zu seinem Tod für die Texte zuständig war (nach seinem Tod schrieb der Franzose Alain Chabat die begonnenen Geschichten zu Ende). Dank Liberatores hyperrealem und grellem Stil feiert der wegen eines Urheberrechtstreits mit dem Kopiermaschinenfabrikanten inzwischen auf Ranxerox umgetaufte Anti-Held bis in die 1990er-Jahre einen weltweiten Erfolg. Während Stefano Tamburini sich anfangs für seine Geschichten von den neuen Studentenunruhen inspirieren liess, erhielten die späteren Ausgaben von Ranxerox mit ihrem Gewalt-Spektakel eine rein ästhetische Funktion. Interessant ist der Band vor allem wegen Liberatores Illustrationskunst und der Umsetzung von Tamburinis Cyberpunk-Zukunft. Zudem wird der Band von einem Nachwort begleitet, das Einsicht in die Entstehung der Figur und der zwei Underground-Zeitschriften Cannibale und Frigidaire gewährt sowie einen kurzen Überblick über den weltweiten Erfolg von «Ranxerox» gibt. Der überaus gewalttätige Inhalt von «Ranxerox» wird aber nur am Rande thematisiert. Es wird lediglich erwähnt, dass vor allem die deutsche Ausgabe der Zensur zum Opfer fiel. Der letzte Band «Amen!» wurde 1998 von der deutschen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 1998 indiziert.
Gar keine Erwähnung findet die für die heutige Zeit problematische Beziehung zwischen der Titelfigur und der minderjährigen Lubna bzw. die teilweise sehr expliziten Darstellungen ihres Liebeslebens. Natürlich gehört dies, wie auch die extreme Gewalt, zur Punk-Attitüde der Autoren und hatte zum Ziel, die Gesellschaft mit ihrer morallosen Kreatur zu schocken. Trotzdem wäre eine Kontextualisierung des Themas aus heutiger Sicht angebracht gewesen. Oder vielleicht findet man in einem Land, in dem ein Ex-Premierminister sich vor Gericht wegen Sex mit Minderjährigen verantworten muss, das Thema nicht nennenswert.
Giovanni Peduto
- Stefano Tamburini/Tanino Liberatore/Alain Chabat: «Ranxerox. Edizione Integrale».
- Comicon Edizioni, 208 S., Softcover, s/w & farbig
- Euro 22
Ingo Clauss (Hg.): Kaboom! Comic in der Kunst

Comic in der Kunst
Um Missverständnissen vorzubeugen, der Katalog «Kaboom! Comic in der Kunst» und die gleichnamige Ausstellung in Bremen, behandelt nicht Comic-Künstler und ihre Werke im Kunstkontext. Vielmehr werden die Arbeiten von bildenden Künstlern vorgestellt, welche die Ästhetik oder auch die Erzählstrukturen des Comics aufgreifen und die Figuren und Helden des Massenmediums in einem Kunstkontext präsentieren. Initiiert und gezeigt wird die Ausstellung in Bremen in der Weserburg, dem Museum für Moderne Kunst, übrigens noch bis Anfang Oktober dieses Jahres. Die Ausstellung spannt einen interessanten Bogen von der Pop-Art bis hin zu aktuellen Arbeiten, von Roy Lichtensteins bunten Rasterpunkten bis hin zu Konzeptarbeiten, Performances und Installationen einer jüngeren Künstlergeneration.
Längst dient der Comic bildenden Künstlern nicht mehr nur als ästhetische Vorlage, als Quelle für Bildmotive, die aus ihrem narrativen Zusammenhang herausgelöst werden, um grossformatige, leicht goutierbare Gemälde zu schaffen. Humorvoll setzen Konzeptkünstler das populäre Bildmaterial ein, karikieren stereotype Vorstellungen und erlauben dabei einen distanziert satirischen Blick auf gesellschaftliche Phänomene. Neben Lichtenstein, Warhol, Polke und Pettibon, die regelmässig in Ausstellungen zum Thema Comic und Kunst auftauchen, finden sich in Bremen zahlreiche Künstler, die es zu entdecken gilt. Ob nun der Afro-
amerikaner William Pope L., der in seiner Videoarbeit «The Great White Way, 22 miles, 9 years, 1 street» als Superman gekleidet den gesamten Broadway in New York entlangkriecht, oder Matt Mullican, der seine Zeichen- und Ordnungssysteme auf Comics anwendet, indem er wiederkehrende Bildmotive aus verschiedenen Comics gruppiert, um sie deuten und strukturieren zu können. Oder die Installation «Waiting for Jerry» des Bildhauers Juan Munoz, bei der man ausser einem beleuchteten Mäuseloch in einem völlig abgedunkelten Raum nur die Titelmelodie des Animationsklassikers «Tom & Jerry» hört.
Die im kollektiven Comic-Gedächtnis verankerten Verweise und Zitate, lösen beim Betrachter eine Vielzahl von Assoziationen aus, die er unweigerlich mit der künstlerischen Arbeit in Verbindung bringt. Ein Effekt, der dem Comic-Lesen gemein ist, wenn die Lücke zwischen zwei Bildern verknüpft wird. Es handelt sich hierbei nur um zwei Unterscheidungen auf Kontextebene. Es ist eine sehr gelungene Auswahl an Arbeiten, die vor allem für Comic-Zeichner eine inspirierende Quelle sind, wie man das Medium Comic sowohl ästhetisch als auch erzählerisch weiterentwickeln kann.
Matthias Schneider
- Ingo Clauss (Hg.): «Kaboom! Comic in der Kunst».
- Kehrer Verlag, 240 S., Hardcover, farbig,
- Euro 29.90 / sFr. 42.90
Katia Fouquet (Ill.) & Albert Camus: Jonas oder der Künstler bei der Arbeit

Künstler bei der Arbeit
1957 erscheint Albert Camus’ Erzählung über die Karriere eines Malers, welche die Höhen und Tiefen des Künstlerdaseins beschreibt. Die Illustratorin Katja Fouquet hat sich dieser Geschichte angenommen, sie farbenprächtig bebildert und in der heutigen Zeit angesiedelt. Camus’ Text überrascht, denn in keinster Weise hat er an Aktualität eingebüsst. Die Sorgen und Nöte eines Künstlerdaseins, die Camus exemplarisch erzählt, von den ökonomischen Zwängen bis hin zu den Abhängigkeiten gegenüber Galeristen und Käufern, galten bzw. gelten damals wie heute. Auch die berauschenden Momente eines kreativen Schaffens, die euphorischen Augenblicke, wenn die Werke mit Begeisterung von Publikum und Presse aufgenommen werden und der Marktwert der Kunst explodiert, finden sich in Künstlerbiographien einer jeden Epoche. Der meist unvermeidlich abrupte Fall kommt einer Vertreibung aus dem Paradies gleich. Einzig die Fallhöhe unterscheidet sich, wenn von einem Tag auf den anderen die Kritiker Verrisse schreiben, das Publikum ausbleibt, der Galerist sich abmeldet, die Käufer verschwinden und zuvor «beste» Freunde nicht mehr gesehen werden.
«Jonas oder der Künstler bei der Arbeit» ist eine zeitlose Parabel, in der sich zahlreiche Künstlerbiographien widergespiegelt finden. Schon allein der Erzählung wegen sollte dieses Buch zum festen Bibliotheksbestand von Kunsthochschulen gehören, aber auch aufgrund der facettenreichen Illustrationen von Katia Fouquet. Denn obwohl es sich hierbei um einen Comic handelt, hat sich die Berliner Illustratorin von formalen Konventionen wie einem wiedererkennbaren Zeichenstil befreit. Stattdessen wechselt sie ihren Stil nach Kapitel, manchmal sogar öfters, weshalb ihr Buch ein besonderes Bilderlesevergnügen bereitet. Neben zahlreichen Motivzitaten aus der Kunstgeschichte, aktuellen wie vergangenen, finden sich surrealistische, naive und absurde Darstellungen. Denn Fouquet hat ihre Illustrationen auf die textliche Vorlage abgestimmt, die sich entsprechend der Dramaturgie ändern. Darüber hinaus zeichnet ihre Adaption des Textes eine sympathische Ironie aus, indem sie sowohl ihr persönliches Künstlerdasein einfliessen lässt als auch zahlreiche Berlinbezüge herstellt. Mit «Jonas oder der Künstler bei der Arbeit» ist Katia Fouquet ein aussergewöhnlicher Comic gelungen, dessen markante Bilderwelt dem Leser nachhaltig in Erinnerung bleibt. Ein mutiger Comic, der einem ästhetischen Befreiungsschlag gleichkommt.
Matthias Schneider
- Katia Fouquet (Ill.) & Albert Camus: «Jonas oder der Künstler bei der Arbeit».
- Edition Büchergilde, 160 S., Hardcover, farbig,
- Euro 24.95 / sFr. 31.15
Sammy Harkham: Everything Together: Collected Stories

Everything Together
Sammy Harkhams gesammelte Geschichten
Es gibt ein paar Zeichner, die eher als Verleger Einfluss auf das Medium haben, wie zum Beispiel Denis Kitchen, der in seiner Kitchen Sink Press Grössen wie Crumb, Spiegelman, Cruse und Wilson verlegte und Meister wie Elder, Kurtzman und Eisner einem neuen Publikum zugänglich machte. Auch Art Spiegelman selbst ist ein Grenzgänger, der sowohl als Schöpfer von «Maus» als auch als genialer Herausgeber des Magazins RAW in die Geschichte eingegangen ist, ähnlich wie Lewis Trondheim in Frankreich oder Chris Oliveros, Begründer des Verlags Drawn and Quarterly, in Kanada.
Der zurzeit wichtigste Zeichner/Verleger ist sicher Sammy Harkham. Bekannt wurde er mit seinem Magazin Kramers Ergot, von dem bisher acht Ausgaben vorliegen (die letzte erschien 2011), in denen er jeweils Werke der «heissesten» Zeichnerinnen und Zeichner versammelte. Die wunderbare siebte Nummer ist ein gutes Beispiel für Comic-Kunst, nicht nur was Inhalt und Ausstattung betrifft, sondern auch weil das Magazin selber ein Stück Kunst darstellt – viel zu gross für die meisten Bücherregale und so schön, dass man es für immer aufgeschlagen auf dem Couchtisch präsentieren möchte. Schon immer ging Harkham bei der Auswahl seiner Autorinnen und Autoren sehr selektiv und wohlüberlegt vor, wählte ausgesprochen künstlerische und konzeptuell arbeitende Zeichner wie Mat Brinkman, Ben Jones und Jim Drain, dann Vertreterinnen und Vertreter der neuen Generation wie Anders Nilsen, Gabrielle Bell und Kevin Huizenga, aber auch etablierte Meister wie Jaime Hernandez, Gary Panter und Ben Katchor.
Harkhams Sammelband «Everything Together», der zwölfeinhalb seiner in den letzten zehn Jahren entstandenen Strips vereint, sorgt nun glücklicherweise dafür, dass Harkhams eigenes zeichnerisches Werk wieder mehr beachtet wird. Seine Zeichnungen erscheinen auf den ersten Blick einfach, aber die Seiten sind mit grosser Sorgfalt gestaltet und er entpuppt sich als intelligenter und tiefgründiger Erzähler, guter Beobachter auch kleinster Details und humorvoller – wenn auch oft fatalistischer und melancholischer – Künstler. Er fasziniert mit seinen Landschaften und Stadtansichten, den Darstellungen von Wohnungsinterieurs und leblosen Objekten; Facetten seines Werks, die manchmal erst beim zweiten Mal auffallen, da seine Geschichten so mühelos zu lesen sind, dass man die Details gerne übersieht.
«Everything Together» ist ein ausnehmend toller Sammelband, wären aber Text und Bilder noch etwas grösser, könnte man sie noch besser geniessen.
Mark Nevins
- Sammy Harkham: «Everything Together: Collected Stories».
- Picture Box, 120 S., Softcover, farbig,
- $ 19.95
Manuele Fior: Die Übertragung

2048
Nach dem Erfolg von «Fünftausend Kilometer in der Sekunde» wagt sich der Italiener Manuele Fior an ein für ihn noch unberührtes Genre heran. «Die Übertragung» ist eine Sci-Fi-Erzählung, die in der nahen Zukunft spielt. Im Jahr 2048 befindet sich Italien im Umbruch. Ein Generationenwechsel findet statt, indem die ältere Bevölkerungsschicht sich müde und unzufrieden aufs Land zurückzieht, während die Jugend die verlassenen Städte besetzt und neue Arten des Zusammenlebens ausprobiert. Traditionelle Gesellschaftsformen wie die Familie oder Paarbeziehungen werden von der Jugendbewegung namens «Die neue Konvention» in Frage gestellt. Die junge Dora gehört dieser Bewegung an und ist beim Psychologen Raniero in Therapie. Sie behauptet, telepathische Kräfte zu besitzen und in Kontakt mit Ausserirdischen zu stehen. Eine Nahbegegnung der ersten Art erfährt («unidentifiziertes Flugobjekt wird aus nächster Nähe beobachtet») auch Raniero wenige Tage vor dem Treffen mit Dora. Nach einem Autounfall beobachtet er leuchtende Dreiecke am nächtlichen Himmel. Eine Erfahrung, die den 50-Jährigen in eine existenzielle Krise stürzt, und aus der er mit Doras Hilfe herausfinden könnte.
Mit seinem stets eleganten, aber weiter stark reduzierten Stil und in Schwarzweiss zeigt uns Manuele Fior eine Zukunft, die gar nicht so unwahrscheinlich klingt. Ähnlich wie in Spielbergs «Unheimliche Begegnung der dritten Art» bleibt der Kontakt zu ausserirdischen Lebensformen nur schemenhaft angedeutet und erzeugt dadurch eine noch unheimlichere Wirkung, die durch das gekonnte Spiel zwischen Dunkelheit und Licht sowie fehlende Lautmalereien verstärkt wird. Die Science-Fiction-Motive sind für den Autor nur ein Mittel, um die Möglichkeiten zukünftiger Formen des Zusammenlebens darzustellen. Dies gelingt Manuele Fior auf intelligente und spannende Art und Weise. Die Erstarrung und Ausweglosigkeit der veralteten Generation hingegen bildet der Comic-Autor mit der sichtbar gemachten Leere der verlassenen Städte ab, die an Schauplätze aus Filmen von Antonioni erinnern.
Giovanni Peduto
- Manuele Fior: «Die Übertragung».
- Avant-Verlag, 176 S., Hardcover, s/w,
- Euro 24.95 / sFr. 37.90
Ibn Al Rabin: Lentement aplati par la consternation

Trauerspiel der Lüste
Bitte lassen Sie sich nicht vom nüchternen Cover und vom umständlichen Titel «Lentement aplati par la consternation» abschrecken: In seinem neuen Comic verzichtet der ansonsten durchaus sprachverliebte Ibn Al Rabin ganz auf Text (aber nicht, wie er im Begleitschreiben betont, auf Sprechblasen).
In «Lentement aplati par la consternation» geht es um Sex. Um Triebe, ums Verführen, Bezirzen, Buhlen, Werben, Anbaggern und Abschleppen, um Hahnenkämpfe und Zickenkriege, um Macht und Lust, um Zweier- und Dreierkisten, und um die Rolle, die der Alkohol dabei spielen kann. Diese Geschichte ist nicht neu, sie ist so alt wie der Mensch, doch ist sie so wichtig, dass sie seit Jahrtausenden immer wieder neu erzählt werden muss.
Um seine Version dieses archetypischen Stoffs zu erzählen, wählte Ibn Al Rabin, der 1975 als Mathieu Baillif geborene Genfer Comic-Autor, als Schauplatz eine Bar mit Terrasse und als Ausgangssituation den Moment, in dem ein Mann sich zu einer schönen Unbekannten setzen will, als just ihr Beau auftaucht.
Auch das ist nicht neu, doch präsentiert «Lentement aplati par la consternation» eine besonders einfallsreiche Fassung dieses Dramas. Ibn Al Rabin, wie immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, erzählt es in vielen tausend kleinen, aber auf grosse Leinwände gemalten Panels – ein stummes und doch gesprächiges Schattentheater, in welchem die minimal gezeichneten, schwarz ausgemalten Protagonisten mittels symbolischer Zeichnungen in den Sprech- und Denkblasen kommunizieren (oder auch nicht).
Auch das ist nicht neu – indes geht Ibn Al Rabin weit, sehr weit und sehr tief. Parallel zu den Dialogen zeichnet er die Hintergedanken und Fantasien der Sprechenden mit. Und die Hintergedanken, die sie in ihren Fantasien haben, und die Hintergedanken, die sich hinter den Hintergedanken in ihren Fantasien verbergen undsoweiter. Schicht um Schicht streift er ab, immer tiefer dringt er in das Innenleben der Figuren, und nur seiner Virtuosität als Erzähler ist es zu verdanken, dass wir uns in diesem kleinteiligen Labyrinth der Lüste nie verlieren.
Die Reduktion auf Typen und Klischees legt den Fokus auf das Wesentliche, das allgemein Verständliche. Gewöhnlich verdrängen wir das, was Ibn Al Rabin zeigt, zumindest ab der Ebene der Hintergedanken hinter den Hintergedanken. Deshalb bereitet es ein umso grösseres Vergnügen, es in diesem Lust- und Trauerspiel zu beobachten. Denn letztlich, das ist ja klar, haben die meisten von uns diese und ähnliche Situationen um Begierden und Enttäuschungen selber erlebt. Das macht «Lentement aplati par la consternation» so grossartig und amüsant.
Sinngemäss übersetzt bedeutet der Titel übrigens «Allmählich plattgewalzt von der Bestürzung». Das passt.
Christian Gasser
- Ibn Al Rabin: «Lentement aplati par la consternation».
- Atrabile Verlag, 24 S., Grossformat (30 x 40 cm), farbig,
- Euro 13 / ca. sFr. 18.–
Max Baitinger: Heimdall
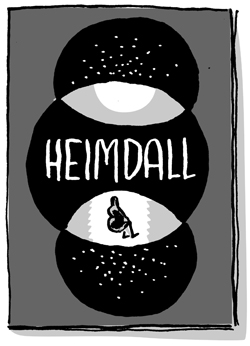
Ein Gott von trauriger Gestalt
Der nordische Gott Heimdall ist der Wächter der Götterheimat Asgard. Er sitzt auf dem Dach von Walhall, bewacht den Regenbogen, der Midgard, die Welt der Menschen, mit Asgard verbindet, und vor allem wacht er über die Sonne: Sollte der gefrässige Wolf kommen, um sie zu verschlingen, wird Heimdall ins Horn blasen, um Götter und Recken zum letzten Kampf wider das Weltende zu rufen.
Mit der «Edda», der Sammlung nordischer Götter- und Heldensagen, wird bekanntlich immer wieder Unfug getrieben – nicht nur ideologisch, sondern auch ästhetisch. In der Regel dient sie als Inspiration für blutrünstige Schlachtengemälde und die Beschwörung übermännlichen Reckentums in Filmen, Comics und Heavy Metal. Erfrischend anders ist Max Baitingers «Heimdall»: kurz, knapp, trocken, garantiert heroismusfrei und damit jenseits aller germanischen Götterklischees. Die schwarzweissen Zeichnungen sind bis zur Abstraktion reduziert, selbst Thor und Odin sehen aus wie stilisierte Zeichen. Die Zeichenhaftigkeit setzt sich auf der Seite fort, ihre Gestaltung ist einfach, lebt aber von raffinierten Symmetrien.
Ähnlich reduziert ist der Text: Lakonisch erzählt Heimdall, wie er dasitzen muss, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert, wie er sich kaum bewegen und insbesondere nicht einschlafen darf, um das drohende Unheil, die Ankunft des Wolfs, nicht zu verpassen. Mit derselben Lakonie und sehr beiläufig verrät er, wie viel er dank seiner Beobachtungen über Götter, Helden und Menschen, über ihre Eigenheiten, ihr Verhalten und ihre Beziehungen in Erfahrung gebracht hat.
Sich im Kreis drehend und mit refrainartigen Wiederholungen erzählen Text und Bild eine letztlich absurde Geschichte, deren tragikomische Auflösung das Ende der Welt wäre. Und diese Verheissung ist, zumindest in diesem Comic, hochkomisch.
Christian Gasser
- Max Baitinger: «Heimdall».
- Rotopol Press, 48 S., s/w,
- Euro 15/ ca. sFr. 21.50
Paulo Monteiro: L’amour infini que j’ai pour toi + The Infinite Love I Have For You

Liebe spielt schrecklich und schön
Paulo Monteiro hat schon vieles gemacht in seinem Leben: Studiert hat er Kunst, Malerei und Theater. Danach arbeitete er als Journalist und Drehbuchautor fürs Radio und fürs Puppentheater, als Kostümdesigner und Bühnenbildner fürs Theater, als Ausstellungskurator oder auch als Traubenpflücker. Seit 2005 leitet er die Comics-Bibliothek und das Comic-Festival in der südportugiesischen Stadt Beja.
Seine Vielseitigkeit überträgt er spielend auf seine Comics, die Einflüsse von so gestandenen Comic-Autoren wie David B., Lorenzo Mattotti oder Loustal verraten, aber auch mit den Liebesmotiven des Künstlers Marc Chagall spielen. Einen blendenden Eindruck seines Könnens vermitteln die zehn Kurzgeschichten, die Monteiro zwischen 2005 und 2010 verfasste, und die er 2011 in Portugal in dem Band «O amor infinito que te tenho» (dt. «Die unendliche Liebe, die ich für dich empfinde») veröffentlichte. Dieser Band ist nun auch in einer französischen und englischen Ausgabe erhältlich.
Es ist ein kleines Meisterwerk, das Monteiro vorlegt: Als Zeichner und als Erzähler beweist er Seite für Seite ein unglaubliches Fingerspitzengefühl für das Befinden der Menschen, ihr Sehnen und ihr Zweifeln. Zauberhaft, empfindsam und zärtlich sind seine Geschichten, voller Achtung seine Porträts, getragen von einer Liebe für den Menschen und einem Ton, für den das Etikett Poesie nur der Vorname ist. Besonders die erste und die letzte Geschichte spitzen die Emotionen einfühlsam bis ins Schaurige zu: In der ersten geht es um die Liebe eines Mannes zu einer Frau, die ihren Weg von der Empfindung in die Sprache nicht findet, sondern stumm und unerfüllt bleibt. Die Bilder sind allegorisch, der Ton melancholisch, und das Schweigen des Liebenden ist intensiver als jede Klage.
Melancholisch heisst dabei nicht traurig oder resigniert: Sehr berührend ist die Geschichte «Weil dies mein Beruf ist». Darin geht es um die Liebe zu seinem Vater und seine Bewunderung, wie dieser sein Leben meisterte. Die Erinnerung, die ihn an seinen Vater bindet, ist für Monteiro die stetige Quelle seines Schaffens. Am stärksten zeigt sich diese Liebe in dem Bild, in dem sein Vater, körperlich vom Alter ausgemergelt, vor dem Fernseher einschläft. Das Bild des gealterten Vaters ist nicht schön. Gerade darin zeigt sich die grosse Begabung Monteiros: Wie er seine Zuneigung vom realen Anblick löst und seine Liebe durch traumhafte Kombinationen von Text und Bild in Kontrast setzt zur sichtbaren Wirklichkeit, ist ganz grosse Klasse. Sein Werk verdient selbst jede Liebe.
Florian Meyer
- Paulo Monteiro: «L’amour infini que j’ai pour toi».
- 6 Pieds sous terre éditions, 64 S., s/w,
- Softcover, Euro 12 / sFr. 18.20
- Paulo Monteiro: «The Infinite Love I Have For You»
- Blank Slate Books (erscheint im Laufe dieses Jahres)
Christopher: Love Song 1 +2

Die Rockmusik wird erwachsen und träumt…
Paris, Mitte der 2000er-Jahre: die Dotcom-Blase ist geplatzt, die Finanzkrise noch in der Schwebe und das Leben in der Hauptstadt ist weder besonders aufregend noch auffallend eintönig. Manu, Sam, Boulette und Greg verdienen ihr Geld als Anästhesist, Leichenbestatter, Polizist und als Statistiker. In der Freizeit spielen sie zusammen in der Rockband «The Sleeping Watermelons». Längst haben sie sich damit abgefunden, dass sie nie einen Nummer-1-Hit landen werden.
Auch sonst fühlen sie sich ganz einer Generation zugehörig, die sich den grossen gesellschaftspolitischen Utopien entsagt hat. Das ist nicht die Generation, die gegen das Establishment revoltiert und, getragen von einer Welle der Beat- und Rockmusik, neue Freiheiten entdeckt und einfordert. Von Arbeitslosigkeit, Geschlechtskrankheiten, Umweltverschmutzung und dem Zerfall der politischen Werte desillusioniert, geht diese Generation der 1970er ihrem Brotberuf nach. Sie sucht sich ihre kleinen Inseln der Freiheit im Privaten und in Nischen.
«Die einzige und radikal neue Leidenschaft, die junge Leute zusammenbringen könnte, ist die Rockmusik. Sie ist ein Ideal, das ihren Wünschen, Trieben und Fantasien, ihrer Freiheit keine Grenzen setzt», sinniert Gitarrist Manu zu Beginn der Comic-Serie «Love Song», die der französische Zeichner Christopher seiner fiktiven Band «The Sleeping Watermelons» widmet.
Das grosse Vorbild für Christopher genauso wie für die vier «Wassermelonen» sind die klassischen britischen Bands der Sechziger-Jahre. Den kreativen Schub, mit dem Bands wie «The Beatles», «The Rolling Stones», «The Kinks» oder «The Who» damals die Rock- und Popmusik eroberten, hat es vorher und nachher in dieser Dichte, Frische und Originalität nicht mehr gegeben.
In vier Bänden rollt Christopher das Leben der «Watermelons» auf, wobei er in jedem Band einen Musiker vorstellt und sein Leben geschickt mit einer Hommage an die vier genannten Bands verbindet: Mit viel Liebe zum Detail lotet Christopher den Alltag der vier Musiker aus und zeigt uns, wie ihre Suche nach Freiheit immer wieder an emotionale und familiäre Grenzen stösst und sich daran reibt. Beatles, Rolling Stones, Kinks und Who bleiben dabei, was Vorbilder nun einmal sind: Ideale für ein Leben, das insgesamt wohlgeordnet, brav und gesittet verläuft, und in dem Sex, Drugs & Rock’n’Roll nicht mehr Symbole des Aufbegehrens sind, sondern Begleiter eines eigentlich ganz netten Lebens. Das gilt auch für «Love Song» selbst: Ein Schuss mehr Biss und Witz hätte dem Comic gut getan, phasenweise erscheint diese Hommage an die wilden Sechziger fast eine Spur zu spiessbürgerlich.
Florian Meyer
- Christopher: «Love Song 1: Manu».
- Salleck Publications, 48 S., farbig, Hardcover,
- Euro 12.90 / sFr. 19.50
- Christopher: «Love Song 2: Sam».
- Salleck Publications, 48 S., farbig, Hardcover,
- Euro 12.90 / sFr. 19.50
Daniel Johnston: Space Ducks No. 1. The Duck War + Space Ducks Soundtrack

Satan vs. Daniel Johnston
Aliens, Satan und ihre Helfershelfer bedrohen die Menschheit und nur eine Einheit von Space Ducks, Entensuperhelden in Raumanzügen, kann nicht nur die Erde in einer seitenlangen Gewalt- und Folterorgie, die jeden Superhelden-Comic alt aussehen lässt («Jetzt essen wir Satans Gehirn»), retten, sondern auch die leicht bis gar nicht bekleideten weiblichen Gefangenen befreien: «Die Enten werden zu legendären Helden ihrer Zeit. Es scheint, als habe die Liebe erneut gewonnen und Sex nicht illegal sei. In einer Science-Fiction-Welt, die man sich merken wird.» Zugegeben, diese Zusammenfassung klingt nicht danach, als müsse man sich Daniel Johnstons Debüt-Comic merken, geschweige denn zulegen. Hinzu kommt: Die Story ist wirr und sprunghaft, die Dialoge hölzern und voller Rechtschreibfehler, die Buntstift- und Wasserfarben-Zeichnungen unbeholfen. Diejenigen jedoch, die das Leben und die seit den frühen 80-ern andauernde Karriere Johnstons als Musiker verfolgt haben (nachzuschauen auch in der beim Sundance Filmfestival ausgezeichneten Dokumentation «The Devil and Daniel Johnston»), werden sich in «Space Ducks» zu Hause fühlen und auf unzählige aus den Songs bekannte Motive und Verweise stossen: Dämonen, Teufel, Ausserirdische, freundliche Tiere, Pornografie und viel Musik. Der an einer bipolaren Störung leidende Musiker, zu dessen Fans unter anderem Matt Groening, Beck oder Tom Waits zählen, gilt als einer der Begründer dessen, was man LoFi-Musik nennt, billig zu Hause produzierte Songs, im Falle Johnstons, zumindest in den ersten Jahren, auf einem Kassettenrekorder aufgenommene Lieder mit Texten, die tief in eine verletzte Seele blicken liessen.
Johnston hat seit seiner Kindheit Tausende Comics – vor allem des Superhelden-Genres – verschlungen und in einem Interview seine Musikkarriere als Versuch beschrieben, bekannt zu werden, um endlich einen Verleger für seine Comics zu finden. Und nun also, mit über 50 Jahren, hat er endlich sein Ziel erreicht. Bei einem einfachen Comic-Album hat Johnston es jedoch nicht belassen: Das Buch enthält Pappfiguren der Protagonisten zum Ausschneiden und wird begleitet von einer parallel veröffentlichten CD, auf der 14 Songs von Johnston und Fans wie Eleanor Friedberger oder Jake Bugg die Geschichte der Weltraumenten mit Musik unterlegen. Darüber hinaus existiert eine App, die den Leser einlädt, sich am Kampf gegen die Weltraumdämonen zu beteiligen. Ein in jeder Hinsicht interaktiver Comic, der einen idealen Einstieg in das «Gesamtkunstwerk» Daniel Johnston darstellt, wenn man als Leser bereit ist, sich auf technische Mängel, LoFi-Comics und -Musik einzulassen. Dahinter nämlich verbirgt sich einer der interessantesten Künstler und herzergreifendsten Musiker der letzten dreissig Jahre.
Jonas Engelmann
- Daniel Johnston: «Space Ducks No. 1. The Duck War»
- Boom! Town, 102 S., Hardcover, farbig,
- $ 19.95
- Daniel Johnston: «Space Ducks Soundtrack».
- Feraltone 2013.
Steffen Kverneland: Munch

Die Welt vs. Edvard Munch
1938 soll der Hannoveraner Dadaist Kurt Schwitters im norwegischen Exil Edvard Munch auf dessen Landgut Ekely bei Oslo besucht haben. Dort drückte Munch Schwitters einen Kaffee in die Hand und schlug ihm die Tür vor der Nase zu. So zumindest erzählt Lars Fiske diese Anekdote in seinem Schwitters-Comic «Herr Merz». Fiskes Kollege Steffen Kverneland (die beiden haben gemeinsam vor einigen Jahren die Künstler-Biografie «Olaf G.» konzipiert) hat sich Munchs Leben auf Albumlänge angenähert, wobei eines beim Lesen schnell deutlich wird: Schwitters war nicht der Einzige, der sich von dem wohl bedeutendsten Künstler Norwegens vor den Kopf gestossen fühlte. Sowohl im privaten Umfeld – Edvard Munch trank gerne, hatte unzählige Affären und konnte (auch aufgrund einer bipolaren Störung) unberechenbares Verhalten an den Tag legen – als auch im künstlerischen, wo seine Werke viele Menschen gegen Ende des 19. Jahrhunderts verstörten. Auf sein berühmtestes Bild «Der Schrei» etwa hat ein Unbekannter mit Bleistift in die bunten Wolken geschrieben: «Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein». «Verrückt» erschien den Zeitgenossen Munchs vor allem seine Abkehr vom Realismus, erst nach und nach erkannte die Kunstkritik die künstlerische Weitsicht Munchs. «Endlich ein Künstler, der sich ungehemmt vom abscheulichen Realismus abwendet, ein Idealist, der seine Werke in Visionen schafft, von innen heraus», zitiert Kverneland einen Text von 1933, zehn Jahre vor Munchs Tod.
Kverneland hat unzählige Bücher über Munch, Zitate von Zeitgenossen, Tagebücher und Briefe des Künstlers, seine Bilder und kunsttheoretische Texte studiert, und aus all dem eine grosse, an vielen Stellen gelungene Collage konzipiert, die nicht versucht, ein einheitliches Bild des Künstlers zu entwerfen, sondern seine vielen Facetten vorzustellen. Das ist ästhetisch meist auf hohem Niveau, da es Kverneland gelingt, Zitate der unterschiedlichsten Stile und Techniken Munchs in seinen Comic zu integrieren; inhaltlich jedoch bleibt «Munch» weit hinter diesem Anspruch zurück. Der Künstler wirkt in Kvernelands Comic wie ein Getriebener, weniger jedoch vom Willen, die Kunst zu revolutionieren, als vielmehr vom Drang seiner Lenden. Statt über seine Frauengeschichten hätte man sich oftmals Tiefergehendes über Munchs Auseinandersetzungen mit der Kunst des 19. Jahrhunderts gewünscht, mehr Klarheit über die Hintergründe, die ihn zu einem der radikalsten Künstler seiner Zeit haben werden lassen, der mit sämtlichen Normen und Erwartungen brach. War Munch ein politischer Künstler? Ein Anarchist? Oder lediglich ein selbstverliebter Provokateur mit bipolarer Störung?
All dies bleibt im Vagen. Selbstverliebt wirken dagegen die Versuche Kvernelands, Parallelen zwischen Munchs und seiner eigenen Biographie herauszuarbeiten oder sich selber auf Fotos, die in den Comic integriert sind, in Munchs Gemälden nachempfundenen Posen zu inszenieren. Munch wollte sein Leben malen, mit allen Qualen, Sehnsüchten und Problematiken. Kverneland hat Munchs Leben gemalt, mit allen Qualen, Sehnsüchten und Problematiken – und dennoch bleibt nach der Lektüre das Gefühl zurück, dass er nicht wirklich an den Künstler herangekommen ist.
Jonas Engelmann
- Steffen Kverneland: «Munch».
- avant-verlag, 270 S., Hardcover, farbig,
- Euro 34.95 / sFr. 50.90
Ulli Lust: Flughunde

Perverse Karriere
Hermann Karnau ist Tontechniker und bereitet eine Grossveranstaltung vor. Kein Rockkonzert – es wird eine Rede sein. Eine Rede des Führers. Wie bedeutsam hierfür die Technik ist, sogar bei einem taubstummen Publikum, das weiss Karnau. «Die hohen Frequenzen für die Schädelknochen, die niedrigen für den Unterleib». Diesen kühlen wissenschaftlichen Blick – zwischen Biologie und Technik hin- und hergerissen – behält Karnau bei. Am Ende wird seine Wissenschaft rassistisch unterfüttert und seine Experimente zur Folter werden. Menschen sind ihm eigentlich fremd und unverständlich, alleine in ihren Stimmen erkennt er einen Ausdruck, den er zu interpretieren vermag. Auch Kinder sind ihm fremd. Das zeigt sich bei den Kindern des «Doktors» – unverkennbar Goebbels, den er häufig besucht. Doch in ihnen sieht er zugleich eine Unschuld, die er an den niedlichen Ahs und Ohs ihrer Stimmbänder auszumachen weiss. Später wird er traurig ihren letzten Atemzügen vor ihrer Vergiftung im Führerbunker auf Schallplatte lauschen.
Nach ihrem meisterlichen Comic-Roman «Heute ist der letzte Tag vom Rest Deines Lebens» legt Ulli Lust mit der Adaption von Marcel Beyers Roman «Flughunde» erneut ein opulentes und nicht minder erstaunliches Werk vor. Auf gut 350 farbigen Seiten kreuzen sich die Geschichte eines Experten für Akustik und die der Töchter von Goebbels. Lust findet für diese ungewöhnliche Perspektive auf das NS-Regime immer wieder erstaunliche Bilder und zieht den Leser emotional, aber auch intellektuell tief in die Geschehnisse. Fassungslos begleitet man Karnaus für die Rassenideologen typische Entwicklung: Hinter seiner netten Erscheinung wird er immer mehr zum abgründigen Ideologen, ohne dass der Person dieser Widerspruch bewusst wird. Während er zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort zu einem Massenmörder wie Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy mutiert wäre, kann er im NS-Regime Karriere machen.
Die bedrückende, von der menschenverachtenden Ideologie geprägte Stimmung fängt Lust in Grautönen und gedeckten Farben ein. Anfänglich sind die Szenen mit den Kindern noch rosa, werden dann immer fahler. Hie und da macht Lust Aussparungen, um Beyers Text in den Griff zu bekommen. Das gelingt gut, denn die Themen des Originaltextes sind auch bei Lust in erdrückender Art präsent. Die letzten Seiten, welche die Tage im Bunker zeigen, sind emotional derart erschreckend, wie man es in einem Comic selten erfährt. Die Schwierigkeit, Töne im Comic darzustellen, gelingt ihr mit leichter Hand. Mal expressiv, und wenn es um den Gegensatz – die Stille – geht, so verlegt sie sich schwer auf die Bilder, bis sich alles im schwärzesten Schwarz auflöst.
Christian Meyer
- Ulli Lust: «Flughunde».
- Suhrkamp, 364 S., Softcover, farbig,
- Euro 24.99 / sFr. 35.50
James Vance & Dan E. Burr: Auf dem Drahtseil
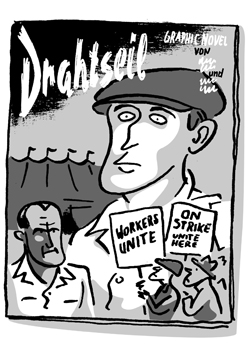
Freiheitsmetaphorik
1988 legten der Autor James Vance und der Zeichner Dan E. Burr die Geschichte um den 13-jährigen Freddie Bloch an, der – nachdem seine Familie Stück für Stück zerfällt – auf der Strasse landet und sich gemeinsam mit dem Hobo Sam auf die Suche nach seinem Vater macht. In «Kings of Disguise» erleben diese mehrere Arbeiteraufstände in Detroit aus der Zeit der Grossen Depression. Der Band erhielt zahlreiche Auszeichnungen und gilt als Meilenstein in der Comicgeschichte.
Fünfundzwanzig Jahre später legen Vance und Burr mit «Auf dem Drahtseil» die Fortsetzung vor: Fred ist inzwischen 18 Jahre alt und Assistent bei einem Wanderzirkus. Die Vorgeschichte wird kurz rekapituliert, danach erzählt der Band in einer Parallelmontage einerseits von Freds Leben bei dem Zirkus: So assistiert er dem Entfesselungskünstler Gordon Corey und schreibt ihm auch die Texte für seine Show. Die sind nicht zufällig von Freiheitsmetaphorik und Anspielungen auf die harten Lebensbedingungen des gemeinen Volkes durchdrungen, ist Fred doch heimlich Mitglied in der Kommunistischen Partei. Der zweite Erzählstrang zeigt zwei Schläger, die für die grossen Stahlfirmen versuchen, von Gewerkschaftlern Informationen über Streiks zu bekommen. «Arbeitnehmerkontrolle» nennen es die Firmen euphemistisch. Dabei schrecken sie nicht vor Mord zurück.
Der Zeichenstil ist dem von Howard Cruse nicht unähnlich, der mit seinem «Am Rande des Himmels» in den 90er-Jahren ja ebenfalls ein wegweisendes Werk zur amerikanischen Geschichte vorgelegt hat. Schwarzweiss, detailreich, und dennoch klar auf die Figuren konzentriert, verfolgt die Geschichte einen nüchternen Realismus. Dabei finden die Autoren immer wieder spannende Methoden, historische Einschübe, Verweise oder parallele Ereignisse in die Handlung zu montieren. Wenn beispielsweise einer der Killer am Lenkrad von einer Revolte des Militärs erzählt, ändert sich der Bildhintergrund entsprechend den verbal beschriebenen Ereignissen. Die genaue Charakterzeichnung der Figuren, die aktuell wieder sehr relevanten gesellschaftspolitischen Themen und die zeichnerisch-erzählerischen Kniffe machen nach «Kings of Disguise» auch die Fortsetzung «Auf dem Drahtseil» zu einer herausragenden Graphic Novel.
Christian Meyer
- James Vance & Dan E. Burr: «Auf dem Drahtseil».
- Metrolit, 250 S., Hardcover, s/w,
- Euro 24.99 / sFr. 35.40
Kurz und Gut
Von Christian Meyer

Woran auch immer Bastien Vivès («Der Geschmack von Chlor», «Polina») beteiligt ist, es ist besonders und besonders gut. Wenn er sich dann auch noch mit Ruppert & Mulot («Affentheater») zusammentut, kann man wirklich Aussergewöhnliches erwarten.
«Die grosse Odaliske» erinnert an Heist-Movies der 60er-Jahre wie «Diamantenraub in Rio», nur dass hier die Emanzipation schon zugeschlagen hat: Die Trickganoven sind Frauen, und sie sind keck, dreist und superschön. Wer für die tollen Farbzeichnungen verantwortlich ist, sagen die Credits nicht – aber sie stehen der wilden Story in nichts nach.
- Bastien Vivès, Ruppert & Mulot: «Die grosse Odaliske».
- Reprodukt, 128 S., Softcover, farbig, Euro 20 / sFr. 25.90
In «Im Himmel ist Jahrmarkt» erzählt Birgit Weye die Lebensgeschichten ihrer Grosseltern, und das macht sie wie schon in ihrer episodischen Erzählung «Reigen» fantasievoll-assoziativ: mal in wörtlicher Rede, mal mit Erzähltext und symbolischen Bilderfolgen. Rund 100 Jahre umfasst ihr Familienporträt, das zugleich exemplarisch 100 Jahre deutsche Geschichte erzählt.
- Birgit Weye: «Im Himmel ist Jahrmarkt».
- Avant-verlag, 280 S., Softcover, s/w, Euro 22 / sFr. 28.50
«Riekes Notizen» von Barbara Yelin («Gift») versammelt Comicstrips der Frankfurter Rundschau aus den Jahren 2011/12: Rieke ist Zeichnerin und versucht, nicht nur Kreativität und Broterwerb unter einen Hut zu bringen, sie muss sich auch noch mit dem Grübelmonster, einem Ethnologievogel und allerhand Alltagschaos herumschlagen. Das macht sie bzw. Yelin sehr farbenfroh und sehr kurzweilig.
- Barbara Yelin: «Riekes Notizen».
- Reprodukt, 96 S., Softcover, farbig, Euro 18 / sFr. 25.90
Kurt Schwitters entfaltete unter dem Begriff «Merz» seine Collagenkunst zwischen Dada, Surrealismus und Konstruktivismus. Der Norweger Lars Fiske widmet sich mit «Herr Merz» dessen Leben. Es ist aber keine gewöhnliche Comic-Biographie, wie zurzeit üblich. Fiske kombiniert Schwitters’ Vita mit seiner eigenen Spurensuche, die sein Erbe erforscht. Das Ganze ist in absurdem Konstruktivismus meets Don Martin gehalten.
- Lars Fiske: «Kurt Schwitters: Jetzt nenne ich mich selbst Merz. Herr Merz».
- Avant-verlag, 112 S., Hardcover, farbig, Euro 29.95 / sFr. 40.90
Raina Telgemeier stand eine gewöhnliche Teenagerzeit mit Zahnspange bevor, als sie sich beide Schneidezähne ausschlug. Die Folge waren jahrelange Besuche bei Zahnchirurgen, obskure Spangen und Klammern sowie: Scham. Davon berichtet die heute 36-Jährige in «Smile» auf über 200 Seiten – farbig, temperamentvoll und tragikomisch. Eine Jugendgeschichte erzählt auch Olivia Vieweg: «Huck Finn» ist natürlich keine Autobiographie, sondern eine Adaption von Mark Twains Roman. Vieweg verlegt die Story an die Elbe der Gegenwart, wo der Ausreisser auf eine Zwangsprostituierte trifft. Gemeinsam stürzen sie sich ins Abenteuer. Während die Zeichnungen souverän sind und ein wenig an Mawil erinnern, wirkt der Spannungsbogen zum Ende hin sehr abgebrochen. Das hätte gut ein Mehrteiler werden können.
- Raina Telgemeier: «Smile».
- Panini, 213 S., Hardcover, farbig, Euro 12.99 / sFr. 19.90
- Olivia Vieweg: «Huck Finn».
- Suhrkamp, 140 S., Softcover, farbig, Euro 19.99 / sFr. 28.90
Mit «Blast» hat Manu Larcenet («Der alltägliche Kampf») ein monströses Projekt gestartet. Sechs Bände à 200 Seiten sollen es werden. Der Inhalt ist ebenso monströs wie der Umfang: Der dicke Polza hat irgendetwas Schlimmes angestellt mit einer jungen Frau. Was, wissen wir nicht. Warum, wissen wir auch nicht. Letzteres wollen zwei Polizisten bei ihrer ausführlichen Befragung herausfinden. Polza erzählt ihnen genüsslich von seinem Ausstieg aus dieser Gesellschaft, seiner Alkoholsucht, seiner Streunerei im Wald, seinen Visionen, seinem Blast. Dem Blast – man könnte es auch Kick nennen – ist Polza auf der Spur, und wir, die Leser, mit ihm.
- Manu Larcenet: «Blast (Bd.1+2)».
- Reprodukt, 208 S., Hardcover, s/w, Euro 29 / sFr. 39.90
Matthias Gnehm geht seine meist universellen Themen ästhetisch sehr unterschiedlich an und baut immer wieder Twists ein. Das gilt auch für «Der Maler der Ewigen Portrait Galerie», wo ein Mann beim Aufräumen alte Familienfotos entdeckt und einem Geheimnis auf die Spur kommt. Spannend und raffiniert, alleine das Finale wirkt etwas unglaubwürdig. Die Eternal Portrait Gallery in der Geschichte hat Gnehm auf www.eternalportraitgallery.com Wirklichkeit werden lassen – dort kann man tatsächlich sein Porträt bestellen.
- Matthias Gnehm: «Der Maler der Ewigen Potrait Galerie».
- Edition Moderne, 256 S., Softcover, s/w Euro 28 / sFr. 39.80
Der Verlag Reprodukt versucht sich nun auch an Comics für Kinder. Darunter sind solche für Kinder ab 3 Jahren, aber auch Stoffe für Schulkinder. «Hilda und der Mitternachtsriese» von Luke Pearson ist für etwas ältere Kinder. Die fantastische Geschichte ist ebenso berührend wie unheimlich. Das eine oder andere Bild könnte mit in die Träume hinübergleiten.
- Luke Pearson: «Hilda und der Mitternachtsriese».
- Reprodukt, 44 S., Hardcover, farbig, Euro 18 / sFr. 25.90
Seine leicht surreal anmutenden, aber dann doch immer recht realistischen Geschichten erzählt der flämische Künstler Brecht Evans mit experimentell anmutenden, wunderschön anzusehenden Aquarellen. Doch auch die zeichnerischen Freiheiten fügen sich in «Die Amateure» immer wieder zu einer klugen und überraschenderweise relativ bodenständigen Erzählung: Ein professioneller, aber erfolgloser Künstler trifft für eine Ausstellung auf einen Haufen Amateur-Künstler. In den lockeren Dialogen tänzeln diese beiden Kunstdiskurse leichtfüssig umeinander herum.
- Brecht Evans: «Die Amateure».
- Reprodukt, 224 S., Softcover, farbig, Euro 34 / sFr. 45.90
Joe Saccos Comic-Reportagen sind längst Klassiker. Der Band «Reportagen» versammelt nun kürzere Arbeiten zu Den Haag, dem Kaukasus, Irak, Malta, Indien und Palästina. Seine Position ist nicht immer sachlich, sondern oft emotional – das macht ihn angreifbar. Andererseits schafft es seine Anteilnahme, den Leser für die beschriebenen Konflikte zu interessieren.
- Joe Sacco: «Reportagen».
- Edition Moderne, 192 S., Softcover, s/w, Euro 24 / sFr. 29.80
Der iranische Karikaturist Mana Neyestani erinnert sich in «Ein iranischer Albtraum», wie er im Jahr 2006 aufgrund einer Zeichnung inhaftiert wurde und schliesslich abenteuerlich aus dem Land fliehen musste. Neyestani beschreibt eindringlich die Willkür des Unrechtsregimes mit einer Mischung aus Horror und groteskem Humor. Den Zeichnungen sieht man den Karikaturisten an – sie sind etwas spröde und lassen räumliche Tiefe vermissen.
- Mana Neyestani: «Ein iranischer Albtraum».
- Edition Moderne, 200 S., Softcover, s/w Euro 24 / sFr. 29.80
Eine Analyse von «Gesellschaftsbildern im Independent-Comic» verspricht Jonas Engelmanns in Buchform veröffentlichte Doktorarbeit «Gerahmter Diskurs». Auf knapp 300 Seiten untersucht er anhand von bekannten (Hergé, Art Spiegelman, Charles Burns, David B., Joann Sfar, Marjane Satrapi) und weniger bekannten Beispielen die Themen Rassismus, Krankheit und Religion. Engelmann geht im Rahmen seines akademischen Diskurses immer wieder ins kleinste Detail und findet faszinierende Verweisspiele in diesem komplexen Medium – auch wenn man ihm da nicht immer bis ins Letzte folgen muss.
- Jonas Engelmann: «Gerahmter Diskurs – Gesellschaftsbilder im Independent-Comic».
- Ventil-Verlag, 336 S., Softcover, s/w, Euro 24.90 / sFr. 40.90
Frank Schmolkes «Trabanten» ist reinstes Genre, und mit Anspielungen auf «Taxi Driver» und Belmondo setzt er klare Signale. Franz kommt aus dem Knast und gerät direkt in neue Schwierigkeiten. Die Bullen, ein rachsüchtiger Prolet und eine junge Liebe begleiten ihn. Schmolke erzählt zügig und sachlich. Mit kuriosen Stilmitteln – der Protagonist wird klein, wenn er sich klein fühlt, die Passanten bekommen schwarze Balken, wenn sie die Gewalt zu ignorieren versuchen – zeigt er inszenatorischen Eigensinn.
- Frank Schmolke: «Trabanten».
- Edition Moderne, 200 S., Softcover, s/w Euro 24 / sFr. 32.–
Gihef & Vanders widmen sich in «Liverfool» der tragischen Geschichte von Allan Williams, dem ersten Manager der Beatles. Von einer etwas unnötigen Rahmenhandlung begleitet, erzählt Williams von seinen Erlebnissen mit den Weltstars in spe und seinen eigenen Schicksalsschlägen. Eine tragikomisch umgesetzte Fussnote in der Geschichte der Beatles.
- Gihef & Vanders: «Liverfool».
- Edition 52, 116 S., Softcover, s/w, Euro 18 / sFr. 25.90
